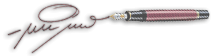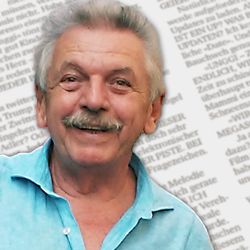Er hat so ziemlich alle Preise, die ein Schreiber in die Finger bekommt, abgeräumt. Selbst China hat ihn für seine Bücher geehrt. Und da war auch der Preis der Volksmusik. Prix Walo. Und all das wunderbare Zeug. Also fährt der Durchschnittsschreiber (für einen überteuerten SBB-Preis und mit Anstandskrawatte) nach Zürich an den Limmatquai.
Denn: Charles Lewinsky ist sein Idol. Wir treffen uns im Bianchi. Alles totschick. Am schicksten die Kellner. Und dann platzt der grosse Schriftsteller im zerknautschten Pullover in diese Pracht. Am Rücken klebt ein Rucksack aus der Bourbaki-Zeit.
NEIN - DEN MODEPREIS WIRD ER NICHT AUCH NOCH BEKOMMEN!
Ich jage in die Toilette. Und schnalle mir sofort die Krawatte vom Hals. Erleichterung: Das Genie ist ein Mensch wie du und ich. Im geschriebenen Wort gibt es wohl kaum etwas, das Lewinsky nicht gemacht hat: Theater, Musical, Sketches, Sitcoms, Filme, Serien – und Bücher: «Ich habe spät mit Büchern begonnen. Natürlich habe ich schon als junger Bursche geschrieben. Aber ich merkte: Ich habe nichts zu sagen. Meinen ersten Roman habe ich niemandem gezeigt.»
Du hast später alles nachgeholt.
«Zunächst einmal musste ich meine Familie ernähren – also habe ich geschrieben, was gefragt war. Irgendwann waren es über tausend Shows für alle möglichen Sender. Jedes Drehbuch machte mir weniger Spass. Ich merkte: Ich bin auf dem Weg zur gut bezahlten Verblödung. Also beschloss ich, damit ganz aufzuhören. Ich habe den Redaktionen mitgeteilt, ich sei nicht mehr verfügbar. Und habe dann mit sanftem Zittern darauf gewartet, dass sich etwas Neues ergab. Ich wollte einfach keinen neuen Schrott mehr produzieren.»
SCHROTT?
«Nun ja – Handwerk. Als Schreiber habe ich mich immer als Handwerker gesehen. Aber erst als Buchautor wurde ich mein eigener Auftraggeber. Die sind ein Stück von mir!»
Mit «Fascht e Familie» wurdest du in der Schweiz berühmt. Die Sitcom räumte ab – eine Million Zuschauer!
«Dabei wollte sie keiner haben. Als ich den Vorschlag machte – ich arbeitete damals beim Schweizer Fernsehen –, wir brauchen dringend eine Sitcom, haben sie grosse Augen gemacht: Sitcom? Was ist das? Ich habe nicht lockergelassen. Und kam schliesslich mit einem Pilot-Drehbuch. Sie liessen es auf Englisch übersetzen. Schickten es nach London. Und holten dort eine Meinung ein – die Antwort habe ich nie gesehen. Aber plötzlich musste alles schnell gehen. Der Abteilungsleiter war ganz aufgeregt: ‹Sofort zwanzig Sendungen. Mit höchstens fünf Personen. 23 Minuten und 30 Sekunden … nicht teuer … nicht aufwendig … sonst hast du freie Hand.›»
«Fascht e Familie» ist heute wieder im Programm. Und auch beim dritten Lauf noch ein Renner.
«Die Pointen ‹verhebe› … sind zeitlos … und die Schauspieler genial: Trudi Roth, Walter Andreas Müller – ich habe die Serie den beiden auf den Leib geschrieben.»
Aber diese nervenden Konserven mit dem Gelächter. MUSSTE DAS SEIN?
«Das sind keine Konserven. Das war live! Wir haben jede Woche vor Publikum gespielt. Manchmal waren die Gelächter zu lang – etwa als Herr Meier als Fliegenpilz auf der Bühne erschien. Da mussten wir das Lachen kürzen.»
Und wie war das mit dem Lied für Maja Brunner und den Grand Prix der Volksmusik?
«Carlo, ihr Bruder, hat mich überredet. Er wollte unbedingt am Grand Prix teilnehmen. Die Bedingung war: nur originale Volksmusikinstrumente. Da habe ich für ‹Das chunnt eus spanisch vor› – die spanischen Kastagnetten mit Löffeli ausgetauscht. Die Jury juckte sofort auf. Und schon bekam ich in der Westfalenhalle einen falschen Bergkristall auf Granit überreicht. Seither gelte ich als Volksmusik-Experte!»
Er grinst: «Ich mache gern das Unmögliche möglich. Wenn jemand zu mir sagt: DAS GEHT NICHT!, versuche ich erst recht die Sache durchzuziehen.»
Beispiel?
«An einer Basler Fasnacht hockte ich mit Bebbi-Freunden an der Drei-Königs-Bar. Ich spöttelte über die Schnitzelbangg-Verse. Ein Wort gab das andere. Und sie wetteten, als Zürcher würde ich nicht imstande sein, an der Basler Fasnacht als Schnitzelbänggler aufzutreten. Das sei eine ganz andere Schreib- und Pointenkultur. Wenig später bin ich als ‹Züri-Leu› mit den Freunden durch die Beizen gezogen. Grosser Erfolg. Und Schulterklopfen: ‹Super, wie du die dummen Züri-Schnöre nachmachst!›»
Du hast auch für Mary alias Georg Preusse geschrieben. Marys Travestie-Show war Kult wegen der guten Texte – aber niemand wusste, dass du dahinterstecktest.
«Georg Preuss – also Mary – kam zu mir, als Gordy nicht mehr mitmachen wollte. Die Texte hatten sie immer zusammen gemacht. Georg merkte: ‹Ich kann das nicht allein.› Marys erster Soloauftritt mit meinen Texten war in ‹Wetten dass …› und wurde gleich zum grossen Hit.»
Du hast dann alle Texte für sie geschrieben.
«Ja klar. Das war auch nur Handwerk – aber Mary war eben auch ein perfekter Handwerker. Auch bei ihm gab es kein ‹Das geht nicht›. Eine Perfektionistin bis in die Knochen. Als er einmal in einer Probe in einem Gorilla-Kostüm auftrat, verhedderten sich seine hochhackigen Pumps darin. Er riss sich alle Bänder. Musste ins Spital. Und die Crew war überzeugt: ‹Das wars dann wohl.› Nach einer Stunde hiess es: ‹Mary ist wieder da.› Georg kühlte seinen kaputten Fuss in einem Kübel mit Eiswasser. Und erklärte, sie werde im Sitzen weiterproben. Jemand schlug einen Gips vor. Die Antwort war: ‹Eine Mary trägt keinen Gips!› An der Premiere trat er auf, als wäre nichts gewesen – dabei muss der Fuss höllisch geschmerzt haben.»
Heute konzentrierst du dich auf deine Bücher. Sie werden in der ganzen Welt verkauft – «Melnitz» war monatelang Bestseller Nummer eins in der Schweiz.
«… dabei hatte ich mit einer Auflage von höchstens 10’000 gerechnet. Plötzlich waren es 50’000 – und als dann allein in Holland die Auflage die 250’000 überstieg, wusste ich: Jetzt kannst du weiterschreiben.»
Du hast deine Schreibklause an der Saône. Direkt am Fluss.
«Ich lebe vom April bis tief im Herbst dort. Ich habe mich während einer Hausboot-Reise in diese Gegend verliebt. Und nach einem Haus gesucht. Bedingung: Es musste am Wasser sein. Es gibt viel Land um die Hütte. Hier pflanze ich Gemüse an. Wir haben Fruchtbäume. Und wir machen alles in Weckgläsern ein. Im Oktober fahre ich mit einem Auto voller Reserven nach Zürich zurück – und leben im Winter von unseren eingemachten Tomaten, Mirabellen, Kirschen.»
Du schreibst dort jeden Tag.
«Von neun Uhr früh bis fünf Uhr abends – mit einer langen Mittagspause. Aber sieben Tage die Woche. Es hat keinen Sinn, bei offenem Fenster auf die Muse zu warten. So holst du dir nur den Schnupfen. Ich schaue auf unsern wunderbaren, alten Baum, der mich an meine Jahre erinnert. Und daran, dass nicht alles ewig dauern kann …»
Hast du Angst vor dem Tod?
«Nein. Das nicht. Meine einzige Angst ist, dass ich nicht merke, dass ich jetzt aufhören sollte, weil die Qualität meiner Schreiberei nachlässt. Und keiner es mir sagen will.»
Neues Buch im Köcher?
Er lacht jetzt mit seinen feurigen Augen: «Ja – eine wunderbare Geschichte über einen unehelichen Königssohn. Mehr verrate ich nicht. Ich habs da mit den Hühnern – erst Eier legen. Dann gackern.»