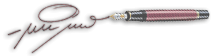Es war ein Schock. Pascal mailte mir die Hiobsbotschaft auf die Insel: KREBS SCHLIESST. Dazu fünf heulende Smileys.
Auch Pascal ist ein Krebskunde. Auch Pascal steht ohne Stöhnen in der ellenlangen Schlange an, um seine Gilbertli oder den Apfel-Schoggi-Gugelhopf zu holen. Und Pascal ist ein grosses Murrmaul. Doch hier, vor der Pforte zum süssen Glück, wird er ungewohnt still. Lächelt sanft. Und hat diesen Blick, als würde er bald durch das schmale Tor ins Paradies eintreten.
Markus Krebs ist mein Hauskonditor. «W a r» muss ich jetzt wohl sagen.
Aber er ist mein Kind – im übertragenen Sinne. Für mich hat er als Ersten filigrane Weihnachtstannen aus Zucker gesponnen. Und für meine Tische hat er Blumen, so zart und zerbrechlich wie Muranoglas, kreiert.
Für eines meiner Benefizessen wollte ich ein spezielles Milieu: einen zuckrigen Tannenbaum. Markus zuckte mit der Schulter: Es gibt da einen in Luzern, der das macht. Aber ich kanns auch selbst mal versuchen. Kreationen aus geblasenem Zucker haben mich stets fasziniert. Doch wer will schon so etwas?»
Ich tippte auf meinen Bauch: ICH!
Das erste grosse Zuckerwerk von Krebs wurde dann ein Schauobjekt, das meinen Gästen den Atem raubte: «Zucker? Nicht Glas? … Das ist ja unglaublich … wo bekommst du so etwas gemacht? München? Paris?»
Ich freute mich auf die Trumpfkarte: «Nein. Beim Quartierbäcker Krebs!»
In der darauffolgenden Woche bekam Krebs ein Dutzend Anrufe: «Könnten Sie für mich auch so einen Zuckerbaum …?»
Er hätte gekonnt. Aber er wollte nicht: «Das mache ich nur für Herrn -minu.»
Süss, nicht?
Er hat für Innocents runde Geburtstage zerbrechliche Rosen, Lilien, Sonnenblumen geblasen. Er kugelte unseren Weihnachtsschmuck aus Zucker. Mitunter findet jetzt so eine Zuckerrose auch den Weg auf seine Schokoladenkästchen, die er mit seinen legendären Whisky-Stengeli füllt.
Markus Krebs ist ein Künstler. Sein Vater – charismatischer Bäcker der alten Schule – war noch für die Kirschenpfannkuchen und die Wähen berühmt. Die Früchte kamen aus dem Garten. Und bis zum Schluss hat Vater Krebs auf dem Holterdiepolter-Karren die Gugelhopfe, Cremeschnitten und Leckerli von der Backstube weit hinter dem Haus vor den Laden gestossen. Die Bleche wurden dann mit all den Köstlichkeiten darauf seinen Töchtern Doris und Beatrix zum Einsortieren übergeben.
Überhaupt diese Töchter! Sie sind die Sonne hinter dem Ladentisch. Ihre sanften Stimmen, ihr wunderbares Lächeln, ihre stoische Unaufgeregtheit machen das Spezielle des Krebsladens aus. Oder eben: HABEN AUSGEMACHT.
Die ganze Familie zieht an einem Strick – Ehefrau Claudine tickert hinter der Backstube im Büro die Buchhaltung ein. Nimmt Bestellungen entgegen. Und taucht sofort hinter dem Ladentisch auf, wenn die Menschen bis zum Ahornhof Schlange stehen.
Apropos: Im «Ahornträff» wollte die Beizerin mit türkischen Wurzeln an der Fasnacht etwas riskieren. Und für die Menschen im Quartier das Restaurant zur Morgestraich-Zeit öffnen. Nur: «Wo bekomme ich die Ziibelewaie her?»
Markus Krebs fackelte nicht lange: «Ich backe die. Das Quartier muss schliesslich zusammenhalten …»
Und so sind im einsamen Aussenquartier am letzten Morgestraich gut 200 Menschen um halb vier Uhr morgens am Spalenring Schlange gestanden: Erstens, um bei Krebs ihre Kääs- und Ziibelewaie abzuholen. Und zweitens, um zehn Schritte weiter gleich ein Stück davon reinzuschieben.
Wenn ich in Italien anreise, fragen sie nicht: «Come stai?» Sondern: «Dove sono i Whiskistengggggeli?»
Von Christine, meiner Adelbodner Bauersfrau und Nachbarin, bekomme ich nur frische, dicke «Niidle», wenn ich ihr die Gilbertli von Krebs spienzle.
Und was passiert jetzt mit meinen Vernissagen? Die Leute kommen doch nicht wegen des neuen Buchs. NEIN. SIE KOMMEN WEGEN DER MINI-FRIANDISES, DIE MARKUS MIR IMMER MIT ROSIGEM GUSS UND FINGERNAGELGROSSEN VEILCHEN VERSÜSST HAT.
Himmel – ich werde sie vermissen, diese handgemachten (die einzigen der Stadt) Fasnachtskiechli … diese Änisbreetli, die nie hart werden … und dieses SLOW-WORLD-AMBIETNE, welche das Lädeli bis weit auf die Strasse ausströmt. Für einen kurzen Moment schenkt es uns diese friedliche Stille, die wir heute alle so nötig haben.
Es ist eben mehr als nur eine Bäckerei. Es ist ein Quartiertreffpunkt. Und während alle geduldig warten, bis Beatrix oder Doris ihr Lächeln aufflammen lässt: «Wär isch draa? …», herrscht draussen auch bei minus 20 Grad diese warme Herzlichkeit, die wir in einer Welt des sterilen Internetalltags immer mehr vermissen.
Kurz: Das Leben ohne die Krebsfamilie ist nur halb so süss.
Ich denke, meine Nachbarin Bea bringt es auf den Punkt. Sie ist alt. Alleinstehend. Gehbehindert. Steht aber in der Schlange an, auch wenn jeder ihr den Vortritt geben will: «Nai … nai … danke. Ich geniesse das Warten hier. Und die Menschen, die mit mir reden. Es ist für mich Leben. Das Leben von früher …»
Nicht nur Bea wird diese kleine Quartier-Insel vermissen. Wir alle. Auch wenn wir der Krebsfamilie das Glück der wohlverdienten Musse in den geliebten Bergen von Herzen gönnen.