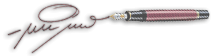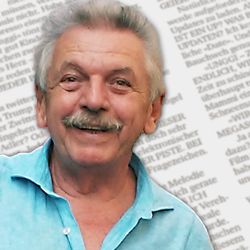Wir treffen uns zum Apéro im «Adlon».
Longdrinks. Auf exotischer Fruchtbasis.
Dazu Knabbernüsschen.
Ich hoovere die Schale alleine rein.
Michi Goldberg ist vernünftig: «Ein Schauspieler muss auf seine Gesundheit achten. Und auf seinen Körper. Es ist sein Material. Und sein Kapital…»
O. k. – das zweite Erdnussschälchen lasse ich stehen.
Er ist jetzt 56. Noch immer jugendlich. Aber nicht mehr der Romeo von einst. Nicht mehr Ferdinand. Er ist Michael Goldberg, einer der renommiertesten Schauspieler in Deutschland – reifer geworden. Markanter.
«Natürlich habe ich alle die jungen Rollen gespielt… aber ich mochte sie nie besonders. Ich freute mich darauf, älter zu werden. Das Rollenangebot ist in diesem Fach einfach interessanter.
Die jungen Helden haben noch nicht viel erlebt. Noch keine Kanten. Sie sind wie Ölflecken auf dem Wasser – sie schimmern prächtig im Licht, schwimmen stets an der Oberfläche. Und gehen nie in die Tiefe!»
Das erste Mal habe ich Michael Goldberg in einer Spoerli-Inszenierung von «Romeo und Julia» in Basel gesehen. Da war er vielleicht 15 Jahre alt. Er gehörte damals zur Edelgarde aus dem Corps von Statisteriechef Kurt Model. Und er durfte stumm, aber mit tragischer Mimik den Tod von Romeo überbringen.
«Ich besuchte zusammen mit Dominique Spirgi und Paddy Hänggi die damalige DMS – die Diplom-Mittelschule. Theater war unsere Abwechslung. Mehr als Hobby – unsere Welt. Und weil wir einigermassen gut aussahen, wurden wir sogenannte Nobel-Model-Statisten – Model setzte uns einfach überall ein.»
Goldberg hat es auch mit Ballett versucht. Bei Walter Kleiber – Spoerlis Ballettmeister aber nahm ihn eines Tages zur Seite: «…du hast viel Kraft im Fuss!»
Goldberg lacht laut auf, wenn er an den Moment zurückdenkt: «Kleibi brachte es einfach nicht über sich, mir zu sagen: Punkto Ballett bist du eine Nuss!»
Er schaut sich in der Halle des legendären Berliner Hotels um: «Sie haben das ‹Adlon› echt gut restauriert … ein Stück Berliner Geschichte.»
Dann bricht sein Lächeln: «Das letzte Mal war ich mit meiner Mutter hier – seither nicht mehr…»
Er vermisst Bea. Die Beziehung zu beiden Elternteilen war stark – so stark, dass er sich schwertut, nach dem Tod der Mutter nach Basel zu kommen: «Irgendwie ist sie dort überall präsent … das schmerzt… wühlt auf… ich bin dann froh, wenn ich wieder weggehen kann… ich brauche wohl Zeit, um heimkommen zu können!»
Immerhin: Heimkommen. Basel bedeutet ein Stück Heimat für ihn. «Ja, klar – meine Tochter Lina lebt dort. Sie ist ein wirklicher Sonnenschein für mich. Meine Schwester bedeutet mir auch enorm viel – sie und ihre Familie. Dieser Teil meiner persönlichen Welt ist also in Basel. Und jeder Einzelne ist mir wichtig.»
Seine Eltern waren starke Persönlichkeiten. Beide. Das geht nicht einfach spurlos an Kindern vorbei.
«Gut – es war eine schöne, problemlose Jugend. Noch heute habe ich alle meine Jugendfreunde am Rheinknie. Wir treffen einander regelmässig – sie kommen an meine Premieren, haben mich in allen Städten Deutschlands besucht. Das ist ein Stück Heimat, ein Stück der eigenen Geschichte, die da anreist – na ja, vielleicht tönt dies jetzt etwas zu melodramatisch. Aber es ist einfach schön, Freunde zu haben, wirkliche Freunde…»
Die Kinderzeit hat er im Basler Neubadquartier verbracht. Später im eleganten Haus auf dem Bruderholz. Doch es waren die allerersten Jahre, die ihn besonders prägten. «Wir haben da nahe an der französischen Grenze beim jüdischen Friedhof gewohnt. Da war einerseits das Bewusstsein: Es gibt auch etwas anderes als die Stadt und dieses Land – die Weite von Frankreich. Und zweitens: das Judentum. Meine Eltern waren – im Gegensatz zu den Grosseltern – keine orthodoxen Juden. Ich bin also nicht strenggläubig aufgewachsen. Aber das Jüdische war da. Und natürlich haben mich die jüdische Kultur und Geschichte geprägt…»
Wie das?
«Nun – es war für meinen Vater nach dem Krieg klar: ‹Wir gehen nie nach Deutschland!› Er war überzeugter Kommunist, später Sozialist – also war auch Spanien mit der Franco-Diktatur kein Thema!
Wir konzentrierten uns auf Italien. Jahrelang fuhren wir auf den Stiefel in die Ferien. Gut, zwei-, dreimal auch nach Frankreich – aber nie nach Spanien. Und ein Schritt über die Grenze nach Deutschland wäre irgendwie Hochverrat gewesen…»
Aber du hattest doch die Schauspielschule in München. Dann das erste Engagement in Deutschland?
«Ja – das war echt ein Problem. In Hildesheim hatte ich meinen ersten Vertrag, mein Debüt. Würde mein Vater kommen? Würde er mich auf der Bühne sehen wollen – auch im verhassten Deutschland?!»
Er kam.
Und es wurde ein einschneidendes Erlebnis:
«Vor meiner Aufführung wollte er den jüdischen Friedhof von Hildesheim besuchen. Also gingen wir hin. Wir waren kaum ein paar Minuten dort, als uns eine Schar junger Leute anmachte: ‹JUDEN RAUS!› – sie lachten. Mein Vater wurde kreideweiss. Es war einer meiner schrecklichsten Momente.
Wir gingen zurück ins Hotel. Und er hat nie ein Wort darüber gesprochen. Damals habe ich kapiert, wie gerne er mich hat. Und selbst diese schmerzhaften Besuche nach Deutschland auf sich nahm, um mich auf der Bühne sehen zu können…»
Später legte sich die Sache etwas:
«Er besuchte mich nun in allen deutschen Theatern. Natürlich immer mit meiner Mutter. Und bevor der Vorhang sich hob, grüsste er nach links und rechts ‹Haben Sie auch jemanden, der mitspielt? Ach nein? Ja, mein Sohn steht hier in drei Minuten auf der Bühne und…› – meiner Mutter war das jedes Mal schrecklich peinlich. Aber mein Vater genoss es. Und war stolz auf mich.»
Waren die jüdischen Wurzeln Vorteil? Nachteil?
«Richtig krass habe ich es nur einmal im Militär erlebt. Ich machte alles, um keinen Dienst leisten zu müssen. Vergebens. Bei der Aushebung las der Offizier meinen Namen laut vor. Und sagte: ‹Solche wie Sie schicken wir zu den Panzern – die müssen doch am Freitag immer früher heim!›»
Nach Hildesheim kam die erste grosse Filmrolle. Es war ein Film über den rumänischen Lyriker Paul Celan:
«Es war ein absoluter Zufall, dass ich die Rolle bekam. Eine Kollegin von der Münchner Schauspielschule jobbte als Kindermädchen beim Regisseur. Dieser hatte das Jugendbild von Celan in den Unterlagen auf dem Schreibtisch liegen. ‹Der sieht aus wie Michi…›, sagte meine Kollegin. Ich musste vorsprechen. Und bekam die Rolle…»
Der Film wurde kein Knaller. Aber die Dreharbeiten damals in Bukarest waren eindrücklich – und die Erfahrungen, die Michael Goldberg machte, ebenfalls: «Es war noch die Zeit des Eisernen Vorhangs. Ich fuhr mit Nylonstrümpfen und Kugelschreibern an den Set…»
Wie hats eigentlich angefangen? Wolltest du immer Schauspieler werden?
«Ja. Schauspieler. Oder Koch. Ich stand ja schon als Dreikäsehoch beim Basler Kindertheater auf der Bühne… und mein erstes Theatererlebnis war «Die lustige Witwe». Ich war so etwas von begeistert – meine Mutter meinte dann daheim: ‹Es war schrecklich – wir müssen am Geschmack des Buben feilen…›»
So. Apéro fertig. Wir fahren zu Michi Goldbergs Lieblingsbeiz in Berlin.
Sie liegt in einer Nebenstrasse des Ku’damms – «Diekmann». Eigentlich ist das Ganze ein weiss gestrichener Krämerladen. Aber als Edelpinte bei «tout Berlin» gross angesagt.
Natürlich kennen sie Herrn Goldberg. Empfehlen den Fisch (auf einem Kohlbeet – ausgezeichnet!). Und bringen eine Flasche Rotwein. (Auch da kennen sie ihn und seinen Geschmack.)
Kochst du eigentlich auch?
«Liebend gerne. Ich geniesse die mediterrane Küche. Und koche auch so. Ich habe den ‹Basler Buben› (gemeint sind die Freunde aus der Statisterie-Zeit) das Kochen beigebracht. Heute überflügeln sie mich…»
Und mit der Filmerei war nach Celan Schluss?
«Nein. Ich habe letztes Jahr mit Dani Levy gefilmt. Das hat grossen Spass gemacht. Wir reiten auf derselben Wellenlänge. Und natürlich habe ich auch Fernsehen gemacht. Serien. ‹Tatort›. So etwas tut man in jungen Jahren – irgendwie musst du ja überleben.
Heute jedoch geniesse ich die Schauspielerei auf der Bühne – das ist eben doch etwas ganz anderes. Jeder Abend ist speziell. Man spürt das Publikum. Beim Filmset ist alles abstrakter…»
Du hast auf allen grossen Bühnen Deutschlands gespielt – München, Köln, Frankfurt – nun bist du im Ensemble des Deutschen Theaters Berlin…
«Ja. Ich weiss, dass ich privilegiert bin… vor allem: Weil ich auf der Bühne stehen darf. Es ist Abend für Abend ein neues Erlebnis. Einfach wunderbar. Man hat den direkten Kontakt mit den Leuten, die da unten sitzen. Und du bekommst die Reaktionen hautnah mit…»
Er überlegt: «Auch das Arbeiten auf eine Rolle hin ist anders als beim Film oder Fernsehen – die Person wächst langsam heran, entwickelt sich, wird mit dem Ensemble und der Regie in allen ihren Schattierungen diskutiert…»
Du bereitest dich jetzt auf die Rolle des Harpagon in Molières «Der Geizige» vor – wie ist das? Wie lernt man so eine ellenlange Textpassage? Beim Fernsehen muss man ja stets nur kleine Sequenzen auswendig können – aber so abendfüllende Stücke…?
«Zuerst denke ich immer: Das schaffst du nie. Und ich weiss auch nicht, wie ich es schaffe. Ich bin ein ungeduldiger Mensch – ich beginne meine Passagen zu lesen. Und werfe dann auch schon mal das Textbuch, wenn ich stecken bleibe, in einem Wutausbruch an die Wand. Aber plötzlich – es ist wie ein Wunder – hast du alles intus. Und du kannst es…»
Berlin?
«Als ich 1999 beim Prenzlauer Berg wohnte, war alles noch kaputt. Grau. Düster. Für den Weg ins Theater brauchte ich 50 Minuten – wenn ich nachts heimkam, war es schwarz in den Strassen, dunkel wie in einem Loch. Heute hat sich alles geändert. Berlin ist luftiger, fröhlicher, heller geworden. Ich lebe nun im Bötzowviertel – ein spannender Stadtteil, wie ein kleines Dorf und eben doch grossstädtisch multikulturell zusammengemixt.»
Er sagt, er sei immer auf der Suche… in jeder Stadt, in der er die Koffer auspacke, wolle er sofort eine Wohnung einrichten. Und sesshaft werden. Bis er die nächste Stadt besucht:
«Ich bin ein unsteter Typ.»
Auch in Beziehungen?
«Auch dort. Ich hatte immer wieder einen Partner. Aber in unserem Beruf ist das schwierig. Wir sind egozentrisch, zu sehr auf uns selber ausgerichtet – oder auf die Figur, in die wir für eine Rolle gerade hineinschlüpfen. So etwas bringt einem Partner nicht das grosse Glück… es wird schwierig!»
Er hat gute Freunde in Deutschland, mit denen er in die Ferien verreist. Oder mit ihnen die Festtage verbringt: «Das Pflegen dieser Freundschaften ist mir heilig. Ich brauche diese Leute… und sie brauchen mich. Ich bin da Seelentröster, Ansprechpartner, die wichtige Bezugsperson – und sie sind es für mich auch: eben wirkliche Freunde. So etwas kann mehr sein als eine Ehe…»