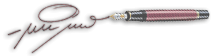Er wirkt unscheinbar. Aber agil. Sportlich. Ein bisschen wie ein Fussballspieler, der vom Platz geht.
Der Tisch ist im «weissen Teil» des Schützenhauses reserviert.
Er trägt offenes Leinenhemd. Jeans. Keine Krawatte: «Das ist das Wunderbare, wenn man kein Banker mehr ist – es gibt keinen Uniformenzwang mehr. Keinen Hermes am Hals.»
Eric Sarasin ist ein Teil des Basler Daigs. Und Teil der Basler Hochfinanz, die jährlich säuberlich nach ihren Millionen in der «Bilanz» auseinandergepflückt wird. Er trägt den Namen einer uralten Basler Familienbank, die es heute in diesem traditionellen Sinne nicht mehr gibt. Und deren stellvertretender Chef er bis 2014 war.
Es war kein schöner Abgang. Da waren diese Steueroptimierungsgeschäfte, Hausdurchsuchungen, Verhöre im deutschen Gericht.
«Es wurde ein Albtraum. Die ganze Cum-Ex-Geschichte war grauenvoll. Ich habe mich geschämt, obwohl ich nach dem Gesetz unschuldig war. Ich habe Fehler gemacht. Und ich fiel daraufhin in ein tiefes Loch…gottlob war die engste Familie da…sie sind alle zu mir gestanden!»
Die Untersuchungstruppe stand eines Morgens einfach vor der Tür: «Meine Frau bereitete für die Kinder das Frühstück vor. Es läutete. Da waren acht Beamte, die einen Durchsuchungsbeschluss vorwiesen. Sie nahmen das Haus in Beschlag. Meine Frau wollte sich etwas überziehen – sie trug den Morgenrock. Sie durfte sich nur in Gegenwart eines Beamten ankleiden …»
Du wurdest dann freigesprochen.
«Und ich will nichts beschönigen. Wir hatten ein Loch im deutschen Steuergesetz genutzt. Und ich musste 200 000 Franken hinblättern. Die Bank hat die meisten Kunden, die zu Schaden kamen, entschädigt. Als die deutsche Richterin mit mir das Gebäude verliess, verabschiedete sie sich: ‹Ich wusste, dass Sie nicht schuldig sind – aber der Name Sarasin klingt zu gut…›»
Zu Hause zitterte der Boden: «Nein – er tat sich auf: Freunde riefen nicht mehr an. Andere wechselten die Strassenseite. Man wird genüsslich für schuldig befunden, obwohl die Fakten noch nicht auf dem Tisch liegen. In solchen Situationen lernst du die wenigen kennen, die zu dir halten. Bei mir war es die Familie – und das war für alle ganz sicher nicht einfach! In der Schule haben sie meine Kinder gemobbt: ‹Dein Vater gehört hinter Gitter!› – Das war schlimm.»
Du warst eigentlich nie ein «Daig-Basler».
«Ich bin als einziger Bub mit drei Schwestern aufgewachsen. Ziemlich wild. Und dank meiner französischen Mutter nicht allzu konservativ. Mein Vater wurde wegen der katholischen Heirat in Daig-Kreisen ‹der katholische Sarasin› genannt. Schon als Kind war ich ein kleiner Revoluzzer. Ich wollte Fussball spielen – das war nicht das, was sich die Leute aus unsern Kreisen für den Sohn wünschten. Ich setzte es aber durch. Und ging nicht etwa zum Stadtclub. Sondern zum FC Breite und erst später zum FCB.»
Du warst der kleine Prinz in der Sarasin-Sippe.
«Ich erinnere mich, dass ich während der Ferien bei meiner Grossmutter in Arlesheim war. Am Abend gab sie ein grosses Dinner. Sie steckte mich in einen Anzug. Es wurde ein Scheitel gezogen – und ich musste eine Krawatte umbinden. Im Esszimmer sassen uralte Menschen (nun ja – aus der Sicht des Buben). Und meine Grossmutter verkündete stolz: ‹Das ist Eric – unser einziger Stammhalter.› Dann wurde ich wieder abserviert. Wie eine halb leere Platte mit Bohnen…»
Die Schule war wohl auch nicht das grosse Ding?
«Katastrophe! – Irgendwie wollte ich den anderen beweisen, dass ich kein so Daig-Dackel bin. Ich liess die Sau raus. Also schickte mich mein Vater nach Steckborn ins Institut…»
Wilder Junge also.
«Kann man so sagen. Diese Wildheit hätte mir fast das Genick gebrochen. Ein paar Kameraden und ich waren in der Toskana. Wir rauften. Ich will einen Angreifer abschütteln, verliere das Gleichgewicht – und er fällt voll auf mein Genick … Sie brachten mich nach Grosseto ins Spital. Das Einzige, das ich noch mitbekam, war ein Mann der unter der Tür stand: ‹Wo ist dieser Sarasin…ich bin Guido Zäch.›»
In der Schule dann weniger Glück?
«Nun. In der Vor-Matur liessen sie mich in Steckborn durchfallen – die dachten wohl: Der reiche Papa kann noch ein Jahr bezahlen. Aber der reiche Papa war nicht blöd, er nahm mich vom Gymnasium und erklärte: ‹Du machst jetzt einen Handelsabschluss. Fertig. Und dein Sackgeld kannst du dir gleich mal an den Hut stecken.›
Ich habe dann als Taxifahrer bei den 33ern mein Geld verdient. Wenn ich übermüdet in der Schulbank hockte, hat mich mein Geschichtslehrer Beat Trachsel tadelnd angeschaut: «Zzzz – Herr Sarasin … sind wir wieder eine Nacht lang im Taxi rumgegondelt …?›»
Wir sind in das Gespräch vertieft – der Kellner kommt bereits zum dritten Mal. Also – leichtes Essen: Melonensuppe. Wolfsbarsch auf Gemüse…
Sarasin ist nach dem Handelsdiplom in die USA weggegangen. Er hat in Boston den Bachelor gemacht. Und wurde bereits mit 27 Jahren ins International Private Banking in die Citibank nach New York berufen.
«Dies ohne irgendwelches Vitamin B. Ich war ziemlich dynamisch. Unerschrocken. Vor allem war ich nicht der Sarasin. Sondern ‹Eric›. Es war eine Befreiung …»
In diesen Jahren hast du auch deine Frau Esme kennen gelernt.
«Sie ist in New York geboren – aber gebürtige Engländerin. Esme arbeitete ebenfalls in der Citibank. Doch sie zeigte mir die kalte Schulter. Das reizte mich. Ich machte ihr den Hof. Und wir haben in New York geheiratet …»
Dann kam der Rückpfiff: «…nun, die Familienbank meinte, ich solle zu einer Sitzung nach Basel fliegen. Ich kam ins Büro. Da empfing mich Alfred, der grosse Doyen der Sarasin-Brüder: ‹Wenn wotsch koo?›»
Er kam zurück. Ohne Privilegien: «Ich musste ganz unten anfangen. Irgendwie wurmte das – in New York hatte ich immerhin Vermögen von anderthalb Milliarden Dollar verwaltet. Ich durchlief mehrere Abteilungen. Im Nachhinein muss ich sagen: Diese Erfahrungen haben mir später viel gebracht …»
Für seine Frau muss es ein Kulturschock gewesen sein – ein Leben in New York. Und jetzt im kleinen Basel. Schlimmer noch: im engen Basler Daig.
«Als Erstes wollte sie die Sprache lernen. Nach drei Wochen Deutschkursen kam sie heim: Sie wolle den Dialekt sprechen… Sie schaffte es bravourös. Esme gibt heute Basler Stadtführungen in perfektem Deutsch und redet auch Dialekt…»
Und der Fussball? Es ist kein Geheimnis, dass du gerne FCB-Präsident geworden wärst.
«Dazu stehe ich. Als Bernhard Heusler mit seinen Leuten bekannt gab, er wolle den Club verkaufen, kam er auf mich zu. Er ist ein guter Freund und bat mich, einen Plan auszuarbeiten. Ich sollte eine Liste mit den Personen meines Vorstands zusammenzustellen. Das habe ich getan. Ich hatte eine gute Truppe. Nun sollte ich plötzlich meine Leute und alle Pläne einem Konsortium vorstellen. Das war etwas dubios – nicht mein Ding. Ich zog die Sache zurück. Aber plötzlich gabs keinen mehr, der den Laden kaufen wollte.»
Dann kam die Lösung Burgener. Du hast dich mit dem bissigen Spruch «…wie eine Misswahl, bei der nur eine dicke Rothaarige antritt», ziemlich in die Nesseln gesetzt.
Ja. Tat mir auch leid. Tatsache jedoch ist, dass ich den Club damals auf 40 Millionen geschätzt habe. Burgener hat ihn für nicht einmal die Hälfte bekommen. Ein Schnäppchen. Danach wurde die Zitrone ausgepresst – das ist sicher nicht im Sinne einer Gigi Oeri, die den Club der ‹Stadt› übergab …»
Aber der Präsidenten-Stuhl würde dich immer noch reizen?
«Ich kann warten…»
Du hast nach der dunklen Cum-Ex-Zeit zurückgefunden. Kein Banking mehr …
«Als ich ziemlich am Ende war, hat Esme mich aufgerichtet: ‹Turn the page…› Die dunkle Zeit war eine Chance, mich frisch zu orientieren. Ich unterstütze heute junge, dynamische Firmen – viele im Digitalbereich. Ich helfe der Genfer 1875 Finance AG, sich als grösster, unabhängiger Vermögensverwalter der Schweiz zu etablieren. Bei der Singularity Group, die mir speziell am Herzen liegt, bin ich Verwaltungsratspräsident. Und sitze auch in andern Verwaltungsräten.
Ein Viertel meiner Zeit investiere ich jedoch für philanthropische Dinge. Ich habe schon 1989 Gelder für Lighthouses und Aids-Kranke gesammelt – oft gehörte Antwort: ‹In unsern Kreisen hat man so etwas nicht.›»
Du bist auch Präsident der Krebsliga, unterstützt das Basler Tierspital, bist imStiftungsrat von Swiss Peace in Bern …
«Das Soziale ist seit Jahrhunderten bei ‹Daig-Familien› im Vordergrund gestanden. Credo: Wenn es den andern gut geht, geht es uns auch gut…»
Die Kinder sind ausgeflogen.
Er strahlt: «Ja – ein Sohn lebt in unserem Londoner Haus, der andere in Boston … meine Tochter ist auf der Schauspielschule in England. Und der Jüngste schnuppert in Barcelona im Hotelfach. Ich möchte, dass sie der Enge unseres kleinen Landes entfliehen – dass sie die Welt erleben. Und ihre Köpfe anstossen. Ich bin für sie da.»
Du selber? Esme? Jetzt wo ihr wieder allein seid…?
«Es gibt viele Dinge, die ich tun möchte: ein Buch schreiben, einen Film drehen – der Sohn von Donovan hat mir ein Drehbuch mit einer interessanten Rolle geschickt. Ich habe abgewinkt: ‹vielleicht mache ich mit – aber ich investiere sicher keinen Franken in einen Streifen, in dem ich auftrete…›» Er lacht: «Esme ist natürlich dagegen. Sie ist die Vernünftigere von uns…»
Er rührt in seinem Espresso: «Wir würden beide gerne nach London ziehen. Aber natürlich bin ich Herz-Basler. Und mit dieser Stadt verbunden. Mit dem FCB. Mit meiner Familie und deren Geschichte hier.»
Er zuckt die Schultern: «Man kann die Wurzeln nicht einfach ausreissen. Sie ziehen dich immer wieder zum Ursprung zurück…»
Was Eric Sarasin mag
Er mag: das Leben, die Menschen und unseren Planeten
Er mag nicht: Armleuchter, Protzer und Fakes