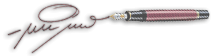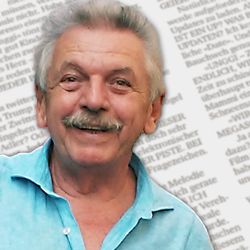Er hat sich das «Donati» gewünscht.
«Einen Tisch, wo wir ungestört sind. Ich bin nicht unbedingt der Beizen-Typ.»
Nun sitze ich vor den leeren Tellern. Und warte. Dabei gehe ich nochmals die verschiedenen Recherchen durch. Er ist Preisträger. Viele Male wurden seine Bauten ausgezeichnet. 2011 erhielt er die Heinrich-Tessenow-Medaille. Na ja, das ist so etwas wie ein Oscar in der Architektur.
In der Laudatio hiess es damals: «Wir würdigen damit das von einer bemerkenswerten und beispielhaften Haltung geprägte Werk des Baslers …»
Architekten aus aller Welt kommen nach Basel, um sein «Forum 3» auf dem Novartis-Campus zu bestaunen. Das Gebäude ist nicht einfach nur Architektur. Es widerspiegelt mit seinem Glaskleid auch die Farben-Geschichte der chemischen Industrie am Rheinknie. Das Gebäude erinnert an die Wurzeln, an den Anfang. Im Sonnenlicht werden die Farben zu einem LSD-Rauschbild. Ungewöhnlich bizarr, ungewöhnlich schön.
«Herr Diener ist zehn Minuten verspätet», meldet der Kellner. Und schenkt Wasser nach.
Also nochmals Notizen: 1999 (damals starb sein Vater) wurde er von der ETH zum Professor berufen. Zusammen mit Marcel Meili, Jacques Herzog und Pierre de Meuron planten sie das ETH-Studio Basel – und das «Institut für die Stadt der Gegenwart». Er hat überall in Europa gebaut, auf der ganzen Welt – und …
ABER DA KOMMT ER.
Mit diesem immer etwas scheuen Lächeln. Mit den beneidenswert üppigen, grau melierten Haaren. Und mit den meerwasserfarbenen Augen, die nun lächeln:
«Sorry, aber heute ist der Tag wirklich krumm gebaut. Telefonate sind manchmal schlimmer als Pressluftbohrer – nervend!»
Er mag nicht viel essen. Leicht. Einen Fisch. Und etwas Salat.
«Nein. Keinen Wein. Nie tagsüber. Alkohol überhaupt nur selten.»
Du bist nicht der gesellige Typ?
«Doch, das schon. Aber ich brauche dazu keinen Alkohol. Und auch nicht viele Leute um mich herum.»
Du bist in Basel aufgewachsen.
«Ja, in einer jüdischen Familie. Allerdings lebten wir nicht nach den strengen Regeln – aber da war meine Mutter, die auf Tradition geachtet hat.»
Und dein Vater. Auch er: Architekt. Hat er dich geprägt, langsam zu deinem Beruf geführt?
«Nein, eigentlich nicht. Durch ihn habe ich schon früh Künstler kennengelernt. Mein Vater war ein Kunstsammler. Es waren aufregende Begegnungen. Und sicher haben sie mich geprägt. Als Schüler habe ich mich damals mit verschiedenen Techniken der Darstellung beschäftigt: Holzschnitte und Radierungen. In den Ferien ging ich sogar manchmal zu einem Schlosser. Dort habe ich geschweisst und gelötet.»
Vor 76 Jahren hat dein Vater das Architekturbüro gegründet. Letztes Jahr grosses Jubiläum – Festlichkeiten?
«Na ja, ich mag es lieber stiller. Wir gingen alle zusammen essen. Alles ganz informell.»
Du hast die Basler Schulen besucht.
«Ja. Zuerst war ich im damaligen MNG, dann im Realgymnasium. Dort hatte ich wunderbare Lehrer, Humanisten. Mit ihnen blieb ich auch später sehr verbunden.»
Und dann doch keine Kunst, sondern der Weg in Vaters Fussstapfen.
«Ja und nein. Ich war mir zu Beginn sehr unsicher, ob ich Architektur studieren wollte. Ein väterlicher Künstlerfreund hatte mir dazu geraten – auch als Grundstudium für eine freiere Tätigkeit. Doch an der ETH wurde intensiv über die soziologischen Fragen hinter der Architektur debattiert. Fragen der Gestaltung traten rasch in den Hintergrund.»
Es war die Zeit der Politisierung an der ETH – auch mit Studentenunruhen?
«Nun, einmal sind wir auch in das Büro des ETH-Präsidenten gestürmt. Ein besonnener Assistent, der uns begleitet hatte, vermochte dann unsere Anliegen verständlich vorzubringen. Zum Glück!»
Und dann wurde es aber doch ein Architekturstudium?
«Mit den Lehrern Aldo Rossi und Luigi Snozzi fand ich zurück zum Architekturstudium. Sie stellten Fragen über die Beziehung des Artefakts zur Natur, zum Territorium und zur Stadt. Es war eine Befreiung! Bis heute haben mich diese Studienjahre geprägt. Sowohl in meiner eigenen Entwurfspraxis als Architekt. Aber auch als Lehrer.»
Nun, in erster Linie baut der Architekt ein Haus und …
«… das stimmt. Am Schluss zählt das Haus, so, wie es dort steht. Einmal gebaut, schützen es auch keine feinsinnigen Erklärungen mehr. Aber sein Entwurf ist doch komplex.»
Inwiefern?
«Soll es ein einmaliges, künstlerisches Artefakt werden, das sich bewusst von seiner Umgebung abhebt? Oder soll es bestehende gestalterische Regeln des Ortes aufnehmen und weiterentwickeln? Alle diese Fragen stellen sich bei jedem Entwurf – selbst bei kleinen Bauaufgaben. Oder auch bei einem Umbau.»
Du steckst da mit Herzog & de Meuron zusammen im «Institut für die Stadt der Gegenwart». Zwei Architekturbüros – und doch zwei verschiedene Welten.
«Ja klar. DAS SCHLIESST SICH NICHT AUS. Es waren auch andere Architekten beteiligt: Marcel Meili aus Zürich, Emanuel Christ, Simon Hartmann. Auch der Soziologe Christian Schmid war dabei. Uns beschäftigten städtebauliche und territoriale Fragen, nicht einzelne Architekturentwürfe.»
Wie habt ihr da gearbeitet? Da hatte doch jeder daneben ein ziemliches Programm?
«An einem Tag der Woche haben wir alle im selben Raum gearbeitet. Wir haben das sehr konsequent durchgezogen. Schliesslich hat es auch sehr Spass gemacht.»
Die Stadtplanung wurde also dein Ding?
«So kann man das nicht sagen. Die Stadt ist ein grandioses Kunstwerk mit unendlich vielen Facetten. Diese überlagern und haben sich über einen langen Zeitraum entwickelt. Das verleiht jeder Stadt ihre besondere Identität. Und das ist es, was uns interessiert. Deshalb widmen wir uns Erneuerungen und Erweiterungen.»
Ein Beispiel?
«Wir renovieren und erweitern die Tonhalle und das Kongresshaus in Zürich. Die Bauwerke überlagern sich aus verschiedenen Epochen. Jetzt wird noch eine weitere Schicht dazukommen.»
Man ist auch Künstler?
«Na ja, Kunst ist zweckfrei. Das ist Architektur nicht.»
Und dennoch bauen sich viele Architekten mit ihren Werken ein Kunstdenkmal.
«Es braucht beides. Eine spektakuläre ‹Signature Achitecture› kann am richtigen Ort grandios sein, etwa das KKL von Jean Nouvel in Luzern. Es kann aber auch sinnvoll sein, auf eine grosse Geste zu verzichten, so wie Herzog & de Meuron beim Stadtcasino in Basel.»
Heute ist das Bauen oft auch mit politischen Fragen verbunden. Es reicht nicht, einfach einen Plan zu einem Haus oder einer Überbauung hinzulegen – es müssen viele Probleme rund um den Bau berücksichtigt werden.
«Ja, das stimmt. Aber das macht es natürlich auch spannend. Ein Beispiel aus den 90er-Jahren: das Warteck-Projekt. Es ging darum, wesentliche Teile dieses Baudenkmals erhalten zu können. Das hatte auch politische Aspekte. Wir mussten vor der Volksabstimmung glaubhaft belegen, dass das Projekt im öffentlichen Interesse sei. Dabei mussten wir den Investoren klarmachen, dass sie gewisse Standards aufgeben müssen. Aber dass es für sie schliesslich lohnenswert wäre. Dazu brauchte es ganz neue Ideen: EINE VISION. Es sollte etwas für die Allgemeinheit entstehen – hier wurde die Aufgabe des Architekten auch eine öffentliche: Wir mussten Überzeugungsarbeit leisten.»
Ja. Aber wie erreicht ein Architekt das öffentliche Interesse für solche Projekte?
«Nun, die öffentliche Wahrnehmung von zeitgenössischer Architektur ist schwer einzuschätzen. Es lassen sich nur einzelne Journalisten dazu vernehmen, die dazu schreiben. Und natürlich sind da auch die Debatten auf Blogs. Doch immer wieder und immer öfter werden Bürgerinitiativen in den Planungsprozess einbezogen. Das geht gut, um die Programme festzulegen. Die Diskussion um die gestalterische Identität eines Projekts bleibt davon jedoch unberührt. Diese findet, wenn überhaupt, post festum statt, also wenn das Bauwerk errichtet ist.»
Aha, da wären wir bei der Schweizer Botschaft in Berlin. Und dem legendären «Bunker».
Roger Diener lacht nun laut heraus.
«‹Bunker› war ein Schweizer Ausdruck. Es gab in der Schweiz mehr Wind um den Bau als in Deutschland. Das Projekt ging damals aus einem Wettbewerb mit ausgewählten deutschen und Schweizer Architekten hervor. In Berlin wurde es mit Interesse begrüsst.»
Und dann?
«Die SVP hat im Nationalrat eine polemische Debatte angezettelt. Sie wollte das Budget für die Erweiterung aus dem Jahresetat für zivile Bauten kippen. Befeuert wurde diese Position durch einen Artikel im «Blick», in dem das Projekt als «Nazi-Bunker» verschrien wurde. Das war für uns nicht einfach.»
Aber der «Bunker» hat viel Anerkennung und Preise gebracht.
«Ja. Bereits zur Eröffnung hat sich Otto Schily, damals Innenminister, in seiner Rede als Laie intensiv mit dem Bau auseinandergesetzt. Danach hat mir Roger de Weck gesagt, dass das ein besonders grosses Kompliment gewesen sei. Das Projekt hat mir auch Türen geöffnet. Kurze Zeit danach wurde ich in den Denkmalrat des Landes Berlin berufen.»
Basel?
«Es ist meine Heimatstadt. Ich liebe sie. Ich bin stolz auf sie. Und ich bin stolz, was die Architektur hier in den letzten Jahrzehnten erreicht hat. Seit einiger Zeit lebe ich mit meiner Frau auch in London. Wir wohnen und arbeiten in einem viktorianischen Künstleratelier mit grandiosen Räumen. Das ist eine echte Bereicherung. Während der Woche arbeite ich am Rheinknie. Aber ich geniesse es auch, eine Distanz zu meiner Stadt zu haben – und so die Probleme hier à distance zu sehen.»
Der wichtige Abstand zu den Dingen also?
«Ja. Abstand ist in unserer Arbeit immer gut. Manchmal übersieht man etwas, weil man der Sache zu nahe ist.»
Auch in Italien, genauer in Rom, steht Roger Diener auf einer Baustelle, gleich bei der historischen und legendären Via Giulia.
«Es wird ein Park werden, eingespannt zwischen der Via Giulia und dem Tiber. Wir gestalten ihn zusammen mit dem Landschaftsarchitekten Günther Vogt. Auch das ist das Resultat eines Wettbewerbs.»
Doch in Rom ist es wie anderswo auch – es muss Überzeugungsarbeit geleistet werden. Bei den alten Römern ist das doch fast noch schwieriger als bei den alten Baslern?
«In der historischen Umgebung haben viele alte Römer Familien ihr Domizil und ihre Palazzi. Wir gewannen die Nachbarschaft auf unsere Seite, als wir anstelle von neuen Gebäuden einen grossen Garten vorschlugen – wie im benachbarten Palazzo Farnese. Doch hier nun als öffentlicher Raum.»
Architektur heute? Was gibst du deinen jungen Mitarbeitern mit?
«Es ist umgekehrt. Für mich ist es faszinierend zu erleben, wie generös und selbstlos der Einsatz von jungen Architekten ist, wenn sie an einem Projekt arbeiten. Das sind zahllose, grossartige Gesten! Natürlich ist Architektur immer ein Risiko. Das Alte und Erprobte weiterentwickeln und Neues erfinden – beides braucht eine Mischung aus Mut und Verantwortungsgefühl. Jedes neue Projekt setzt dich von Neuem dieser Herausforderung aus.»
Er wird nun leiser:
«Die Neugierde ist ein wichtiger Faktor in unserem Beruf. Ohne eine fast unersättliche Neugierde an den Menschen und ihrem Tun kann ich mir eine glückliche Praxis als Architekt nicht vorstellen. Dieselbe Neugierde bezieht sich auch auf das Artefakt und seine Produktion sowohl als handwerklicher als auch künstlerischer Gegenstand. Solche Überlegungen und Auseinandersetzungen versuche ich mit jungen Architekten zu führen.»
Er lächelt nun.
«Schliesslich geht es in der Architektur immer um Menschen.»
Was er mag: Loyalität. Rom, London, Basel. Herausforderungen.
Und was er nicht mag: Viele Leute um sich herum. Interviews.