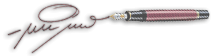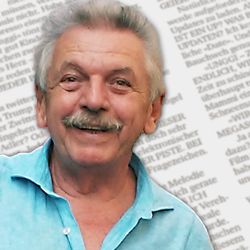Wie immer – ich bin zu früh.
So bleibt Zeit, mich auf den Gast einzustimmen. Heute ist es Annetta. Annetta Grisard. Wir treffen uns in der Basler «Kunsthalle».
Annetta? – Schön. Nein, eine sehr schöne Frau. Das sagen alle. Und selbst die frauliche Neidwelt muss es sich seufzend eingestehen.
Dann: klug. Maturität. Typus B. Später Schule in Cambridge. Und noch später: Richterin am Basler Zivilgericht. Und: Trustee an der Tufts University in Medford, einem Vorort von Boston.
Dass sie von der Schmidheiny-Seite her zu den reichsten Familien der Schweiz gehört, ist Nebensache. Ihr Urgrossvater hat Kieselsteine aus einem Bach geholt. Und daraus Zement gemacht: «Da muss einer eben draufkommen. Die Idee haben – das ist das eine. Aber Ideen u m s e t z e n – das ist der echte Challenge. Das schaffen die wenigsten…»
Der Grossvater hat später dann bereits Zementwerke in Ägypten geführt. Dort ist er auch mit einem Kleinflugzeug abgestürzt. Und war tot.
Annettas Pate sass hinten. Und überlebte.
Sie ist auch etwas zu früh. Menschen, die viel reisen, sind immer überpünktlich. Und bauen bei jedem Termin ein paar Sicherheitsminuten ein.
Auf einer ihrer Reisen habe ich Annetta kennengelernt. Es war in New Orleans. Wir besuchten die Dreharbeiten zu Arthur Cohns «The Yellow Handkerchief». Annetta hatte den Film mitfinanziert.
Der Hauptdarsteller und Oscar-Preisträger William Hurt spielt darin einen entlassenen Strafgefangenen. Um sich in die Rolle einzufühlen, liess er sich etwa zwei Stunden ausserhalb von New Orleans zusammen mit den «Lebenslänglichen» in ein Gefängnis einsperren. Und erzählte uns von seinen Gefühlen.
Zwei Tage später besuchten Annetta und ich das Gefängnis, das auch heute noch Todesstrafen vollzieht. Wir sahen die Männer, die auf ihren Tod warteten – zum Teil abgestumpft. Still. In diesen engen Zellen mit den Gitterstäben. Sie schauten teilnahmslos auf einen Fernseher, der ausserhalb der Zellen für alle im Gang flimmerte.
Andere jagten wie Tiere in einem offenen Käfig auf dem Hof herum.
Als wir an den Gefangenen vorbeigingen, versuchten sie uns zu berühren.
Auf der Heimfahrt sprachen wir kein Wort. Im Hotel angekommen, zog sich Annetta zurück: «Ich muss das zuerst einmal verschaffen.»
Sie malte. Es ist ihre Art mit Gefühlen fertigzuwerden – und so mit den Diskrepanzen, der Ambivalenz in ihrer Welt umzugehen. «Wenn ich male, fühle ich mich frei …», sagte sie einmal.
«Etwas Leichtes» – lächelt sie den Kellner an. Und entscheidet sich für «Fisch».
Keinen Wein («braucht es nicht»). «Vielleicht einen Espresso nach dem Essen – ich sollte um halb drei wieder bei Guschti sein.»
Guschti ist Gustav Grisard. Ihr Mann. Die goldene Hochzeit haben sie längst hinter sich.
Seine Familie hat mit Holz ihr Geld gemacht. Heute betreut Sohn Felix die 2,6 Millionen Immobilien-Quadratmeter. Der junge Verwaltungsratspräsident gilt in Wirtschaftskreisen als Geschäftsgenie, seit er mit der Hiag an die Börse ging. Und gross Furore machte. Die Grisards sind die grössten privaten Landbesitzer der Schweiz.
«Geld stand nie an erster Stelle…», sagt Annetta mit dem unschuldigen Lächeln derjenigen, die sich nie um Geld kümmern mussten. «Die nicht pekuniären Werte sind die wertvollen im Leben…»
Ich schaue fragend vom Teller hoch. Und sie führt es näher aus: «Ganz einfach – ich fühle mich schlecht … mache mir Sorgen um den Gesundheitszustand meines Mannes … bin traurig. Und da kommt jemand aus der Nachbarschaft auf mich zu. Schenkt mir ein Lächeln. Drückt mir die Hand. Und fragt einfach: ‹Kann ich etwas tun?› – d a s sind die Werte des Lebens. Solche Augenblicke, welche dich auffangen. Und nicht alleine lassen.»
Sie ist Zürcherin. Hat trotz der vielen Basler Jahre auch nie ihren Dialekt abgelegt («weshalb auch?»). Und ist als kleines Mädchen in Zollikon in die Primarschule gegangen. «Barfuss» – wie sie betont.
«Meine Eltern waren beide Ärzte. Aber es war Krieg – und mein Vater im Militär. Also hat meine Mutter die doppelte Last gehabt: die Familie betreuen. Und die Praxis führen.
Es erging ihr wie wohl vielen Frauen damals – die Männer waren weg. Und sie mussten den Karren alleine ziehen…»
Sie machte die Matura. Aber die Eltern meinten «das reiche nicht. Ich solle einen weiteren Abschluss machen. Jus. Oder Lehrerin… also besuchte ich das Oberseminar… ich begeisterte mich speziell für die musischen Fächer… Musik… Theater… Malerei.»
Nun strahlen ihre Augen: «Wir sind als Familie immer nach Italien in die Ferien gereist. Am ersten Tag schon hat unser Vater Malblöcke verteilt. Das war Glücksgefühl pur. Italien bedeutet für mich auch heute noch malen…»
Sie engagierte sich bei den Pfadfindern. Wurde Abteilungsleiterin: «Mich interessierten stets die ‹schwierigen Kinder›. Wichtig war mir, sie in die Gruppe integrieren zu können…»
Später, als sie in Riehen in einem Heim für «schwierige Kinder» als Lehrerin arbeitete, kam ihr die Begabung, Menschen intuitiv zu verstehen und zu integrieren, zugute.
Basel?
«Nun – das kam mit Guschti. Er war ein Studienkollege meines Bruders in Harvard. Eines Tages tauchte er bei uns zu Besuch in Zürich auf. Ich bin da eben auf dem Velo vors Haus geradelt – später hat er immer wieder erzählt, er habe sich Hals über Kopf in die Velofahrerin verliebt! Na ja – wie sonst lernt eine Zürcherin einen Basler kennen?!»
Sie jobbte damals in Rom in einem Architekturbüro – der verliebte Guschti fuhr ihr nach: «Na ja – und dann war bald einmal Hochzeit. Und ich kam nach Basel. Das war ein freudiges Kommen. Denn Zürich war zu jener Zeit doch noch ziemlich puritanisch – und Basel hatte schon damals den Ruf, ‹offen› zu sein. Irgendwie aufgeschlossener für Neues. Frisches. Für andere Wege – auch in der Kunst. Jedenfalls habe ich mich hier sofort wohlgefühlt…»
Sie heiratete in eine Familie am Rheinknie. Kein Daig. Aber bedeutend. Sie selber kam von einer angesehenen Familie aus der Limmat-Stadt.
Spannungen?
«Nein. Gar nicht. Viele haben sich hier rührend um mich gekümmert – und da war ja auch bald schon meine eigene Familie, die vier Kinder … na ja: Vollprogramm. Ich hatte keine Zeit, Gedanken nachzuhängen, ob die Welt mich mag oder nicht.
Eine Basler Freundin aus dem sogenannten Daig hat zur selben Zeit einen Geschäftsmann in Zürich geheiratet. Sie hat mir einmal lachend am Telefon erklärt: Wir machen beide so ungefähr dasselbe mit…»
Es gibt also auch einen Zürcher Daig?
«Nun nicht gerade so wie in Basel. Aber natürlich gibt es auch hier die alten Familien. Und dann die Zunftleute. Das war mir immer alles ziemlich egal…»
Die Kunst? Malerei? Fotografie?
«Nun – ich habe mir stets eine Auszeit von der Familie für meine Kunstinteressen ausbedungen. Ich besuchte Kurse, auch die Schule für gestalterische Weiterbildung. Und ich habe die Kunst natürlich auch in die Erziehung eingebaut…»
Sie lacht nun offen heraus:
«…Wenn ich meinen Kindern glauben will, war ich eine ziemlich strenge Mutter… Lehrerin eben… aber ich habe mit ihnen aus Styropor schon Kunstwerke geschaffen… sie waren da von Mark Tobey inspiriert.
An der Art haben die Kinder unabhängig die Messe besucht. Wir trafen einander nach dem Messerundgang – und jeder durfte sein ‹Lieblingsbild› erklären. Und vorstellen. So hat uns Salome schon sehr früh zu einem kleinen Ölbild von Warhol verholfen…»
Du wurdest Richterin.
«Ja. Am Zivilgericht in Basel, 18 Jahre lang.»
Du hast auch als «Verwaltungsrätin» im Ausschuss der Tufts University zehn Jahre die ganze Welt bereist. Und Universitäten auf allen Kontinenten besucht.
«Das war eine spannende Zeit. Ich bin noch heute mit der Tufts University eng verbunden. Die leiden jetzt so ziemlich unter Trump…»
Reisen? Die waren dir wichtig…
«Sie haben mich zu meinen Arbeiten geführt. Ich fotografierte. Und ich verschaffte die Eindrücke zu Hause. Es waren stets die Gegensätze, die mich faszinierten … es ist sehr oft die Rückseite der Medaille, die mich beschäftigt. Denn alles hat zwei Seiten. Und diese Spannung versuche ich aufzuarbeiten – seis mit Pinsel, Fotos, Spachteln, Bürsten…»
Deine Kunst hat sich in den letzten zehn Jahren in eine andere Richtung entwickelt…
«…nun, das kam mit dem Aktionskünstler Hermann Nitsch. Ich besuchte 2005 sein Seminar in Salzburg. Wir waren keine grosse Klasse. Aber der Mann übersah mich und meine Arbeiten einfach. Ging gar nicht darauf ein. Ich war Luft – nicht nur ich. Auch meine Kunst…»
Du warst frustriert?
«Nein. Aber wütend. Am vorletzten Kurstag holte ich meine Farben. Und warf sie zornig an die Leinwand. Ich spürte plötzlich, wie sich etwas auftat. Ich fühlte mich frei, arbeitete mit den Farbklecksen – und hörte Hermann Nitsch hinter mir knurren: ‹Na also – das ist doch schon recht gut. Das hat Feuer. Das hat Ausdruck. Das stellen wir aus…›»
Zu Hause hast du dann weitergemacht?
«Ja. Ich arbeitete wild drauflos. Aber mir fehlte das Urteil. Hermann Nitsch war ja nicht mehr da.
Also kontaktierte ich Klaus Littmann. Und zeigte ihm zuerst meine alten Bilder. Er sass auf seinem Stuhl. Und sagte kein Wort.
Dann holte ich die neuen Werke. Und jetzt schaute er mich an: ‹D a s ist es! Vergessen Sie das andere! Das sind S i e !›»
Er hat diese Werke dann ausgestellt?
Sie grinst. «Ja. Und wir haben nicht schlecht verkauft…»
Das war der Anfang. Annetta Grisards Bilder, Installationen und Fotos (die sie auf ihren Reisen schiesst und oft in ihre Werke einbringt) machen Furore. Ihre «Fire Sites» liessen die Kunstwelt aufhorchen. Die Kunst hat eine Aussage, wie das Feuer, das sie damit besingt: Einmal ist es Wärme. Licht. Hoffnung. Liebe – und dann ist es Vernichtung. Gefahr. Zerstörung. Elend:
«Es sind einmal mehr die zwei Seiten, die mich faszinieren. Und mit denen ich mich auseinandersetze…»
Annetta Grisard reflektiert ihre Umwelt kritisch. Die Eindrücke ihrer Reisen nach Syrien, Uganda, an den Südpol werden in grossformatiger Malerei verarbeitet – und zeigen die Diskrepanzen in dieser Welt auf: Schönheit und Verderben, Freude und Leid.
Sie hat es mit dem Namen Annetta Grisard nicht einfach, als Künstlerin akzeptiert zu werden. «Ich begegne oft herablassendem Hochmut, gönnerhaftem Schulterklopfen – na ja, so im Sinne: ‹Ach Gott – die reiche Gattin, die sich in der Kunst austobt.› Das ist verletzend. Und ungerecht. Man wird wegen seiner Herkunft einfach abgestempelt – und nicht für voll genommen…»
Familie?
«Natürlich ist mir die Familie besonders wichtig. Die Kinder unterstützen mich bei der Betreuung meines Mannes ganz enorm.
Mein Sohn ist ein grossartiger Geschäftsmann – die Töchter haben Karriere gemacht. Und Erfolg. Drei von ihnen sind irgendwie im Familienunternehmen ‹eingebunden›.
Und dann ist da natürlich Guschti – der Mann, der sich in die kleine Velofahrerin verliebte…»
Sie schaut nun über die Espressotasse ins Weite:
«Er ist krank. Und er braucht mich. Er ist für mich jetzt das Wichtigste…»
Ihre Stimme wird leiser: «Manchmal versuche ich mir vier Stunden für meine Kunst freizuschaufeln. Ich jage dann ins Atelier. Und will arbeiten. Aber da ist eine innere Blockade. Nichts passiert. Und ich gehe wieder zu Guschti nach Hause zurück…»
Sie steht nun lächelnd auf. «Apropos… ich muss…»
«Eine grossartige Frau», sagt der Kellner und schaut ihr bewundernd nach. «Eine Persönlichkeit… schön, gescheit, reich.»
«Ja», lächle ich. Und denke an die Worte von Annetta: Die Medaille hat stets zwei Seiten.
Was Annetta Grisard mag
Sie mag: Fotografie, Diskrepanzen, Reisen
Sie mag nicht: Überheblichkeit, Neid, Ungerechtigkeit