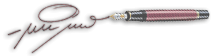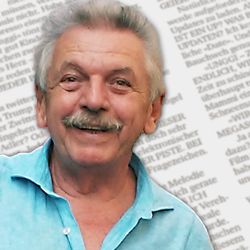«Röschti-Bar?»
Die Berliner Taxifahrerin schüttelt unwillig den Kopf: «Det kenn ich nicht.»
Wir stottern in ihrem klapprigen Opel durch Berlin Kreuzberg: Kebab-Buden … viel schrilles Jungobst …grüne, blaue, rosa Mähnen… Tattoo-Studios… die bröckelnden Mauern voll von Graffiti: FUCK YOU!
«Es ist ein kultureller Treffpunkt…», versuche ich es.
«Det is schrill», lacht die Rothaarige am Steuer. «Uf Kultur machn s hier alle…»
Schliesslich büxt die Karre in die Mariannenstrasse. Ich entdecke ein weisses Schild. Mit Schweizerkreuz. Fast ein bisschen nach Hause kommen:
«Dort ist es – das Blech mit der Helvetia…»
Die Fahrerin steckt sich nun eine handgedrehte Zigarette zwischen die Lippen: «Ach det iss es? Det is ein geiler Jazz-Schuppen…»
Nun – ein bisschen siehts hier tatsächlich nach Harlem aus.
Von Jazz-Bude dann kein Schimmer. Ich schaue durch die Fester: Die Beiz ist proppenvoll. Zumeist junges Publikum.
Sie gabeln Gemüsegratins. Röschti. Menü: «Auberginen-Auflauf. Salat». Das Ganze für weniger als sieben Euro.
Man sollte Berlin Kreuzberg nicht in einem Cashmere-Mantel aufsuchen. Da fühlst du dich wie die Schwarzwälder Torte im Kohlbeet. Deplatziert. Falsch. Und unsäglich alt.
Das Quartier ist fasziniernd. Und ich beobachte Jennifer für eine Weile hinter dem Fensterglas. Sie hat jetzt eh keine Zeit. Ihre linke Hand balanciert drei Teller. Mit der rechten zupft sie eine leere Wasserflasche weg. Später erzählt sie: «Wenn ich Geld brauchte, habe ich immer gekellnert. In diesem Beruf lernst du die Menschen kennen – ich habe da mehr mitbekommen als in der Schauspielschule.»
Ich schlendere also noch durch den Kiez, wie das hier heisst: Eine Frauenfabrik fabriziert handgemachte Schokolade … und ein türkischer Teemann ladet mich zu einem Wasserpfeifchen ein. Er macht mich mit seinem Onkel bekannt, der eine Strasse weiter Kelim-Teppiche vertreibt.
«Jennifer?» – alle lachen. «Sie ist fast ein bisschen der Motor unseres Kiezes. Nun ja – das Herz aus Helvetien.»
Ich betrete eine Stunde später das Restaurant. Jennifer Mulinde steht am Tresen. Zählt Geld. Verteilt Scheine auf kleine Häufchen und sagt: «Nur eine Sekunde – ich muss noch die Trinkgelder ausrechnen!»
Der Buffetbursche grinst. «Das macht sie akribisch genau. Einmal Schweizerin – immer Schweizerin!»
Sie quirlt herbei. Und strahlt wie tausend Sonnen: «Wir haben dich anfahren sehen. Hier entgeht niemandem etwas. Das ist wie in einem Dorf –von wegen Grossstadt!» Ihr Lachen perlt. «Frutigen ist eine Weltstadt dagegen.»
Frutigen?
Sie setzt sich zu mir: «Du musst unsere Röschti pobieren. Alle kommen hierher, um Röschti zu essen. Und Fondue natürlich. Sie wollen etwas Schweizerisches erleben – dann sehen sie mich: Die schwarze Helvetia…das ist natürlich für viele krass. Und ich geniesse die verblüfften Gesichter.»
Frutigen? Helvetia? – Jennifer Mulinde setzt sich zu mir. Bestellt ein Mineralwasser. Und nickt: «Vater aus Kenia … Mutter aus Uganda … ich, einjährig, in Frutigen!»
Alleine?
Nein – natürlich nicht. Sie sei mit ihrer Mutter in die Schweiz gekommen. Als Baby. Der leibliche Vater habe sich abgesetzt.
«Meine Mutter lernte im Zug dann meinen anderen Vater kennen. Die beiden verliebten sich sofort ineinander. Und er heiratete sie – ein waschechter Schweizer. Mehr noch: ein Berner. Dazu.Oberländer. Und – jetzt halte dich fest! – bei der SVP. Ich hätte ihm deswegen manchmal den Kopf umdrehen können…»
Sie liebte ihren Vater – trotz SVP: «Wenn ihn Freunde auf seine Frau, mich und die SVP mit dummen Witzchen anmachen wollten, verteidigte er uns sofort: ‹Das ist etwas ganz anderes. Die gehören zu mir. Und sind bessere Schweizerinnen als viele mit dem alten Berner Stammbaum…›»
Jennifer lächelt nun etwas stiller: «Er war ein wunderbarer Mann – eigentlich weit offener als viele andere, die stets das Lied der Toleranz anstimmen…»
Und Frutigen? Wie war das?
«Mehr als o.k. Es war wunderbar, dort in die Schule zu gehen. Natürlich war ich der Klassen-Clown. Die Leute akzeptierten mich, wenn ich den Clown spielte … vermutlich hat mich das dann geprägt, so dass ich später in die Comedy-Sparte einstieg. Singe, spiele, tanze – und sie vergessen, wer du bist. Die Schauspielerei und Clownerie halfen mir, eine andere Identität zu kreieren.»
Sie ging dann zur Ausbildung nach Winterthur und Zürich. Bekam ein Stipendiat für die Schauspielschule. Und vor fünf Jahren auch einen Award für die «beste Schweizer Nachwuchsschauspielerin».
«Das war nach dem Film ‹Die Standesbeamtin›.» Ich hatte dort nur eine kleine Rolle. Aber doch ziemlich Erfolg damit…»
…und dann kam also der g r o s s e Erfolg?
Wieder das Lachen: «… überhaupt nicht. Ich bekam zwar hin und wieder ein Angebot. Aber als schwarze Schauspielerin wirst du auf die Rollen ‹Putzfrau› oder ‹Hure› limitiert. Irgendwie wollte ich raus aus diesem Cliché-Rahmen. Einfach weg. Und so zog ich nach Berlin…»
Weshalb gerade Berlin?
«Ich hatte gehört, dass die Stadt sehr aufgeschlossen, jung und voll von Möglichkeiten sei. Berlin sei d i e Alternativszene für junge Kunstschaffende. Nicht nur für Schauspieler – auch für Poeten, Musiker, Maler. Kurz: Man sagte und sagt noch immer, dass hier die Post abgehe…»
Und – geht sie?
«Nun – die Stadt bietet unglaublich viel. Man kann sich 24 Stunden lang rund um die Uhr amüsieren. Du kannst von einer Party zur nächsten jagen, kannst ein riesiges, kunterbuntes Kulturangebot nutzen. Aber natürlich birgt so eine Hektik auch Gefahren…»
Inwiefern?
«Man muss sehr diszipliniert sein, um überleben zu können. Ich glaube, dass 90 Prozent von den jungen Menschen, die hier die Kulturszene aufmischen wollen, von Berlin aufgefressen werden. Die Chance, in diesem Moloch unterzugehen, ist sehr gross. Da muss einer stark sein – oder jemand starken zur Seite haben…»
Du bist also eine starke Frau?
«Sagen wir es so: Ich bin eine Frau, die viel arbeiten kann. Mindestens 18 Stunden am Tag! Ich kam hierher. Und habe in diesem Schuppen gekellnert. Um ehrlich zu sein: Es war eine miese Spelunke. Hier wurde gedealt, gekifft – das Ganze war schmuddelig. Und düster.
Der Besitzer war froh, dass da eine aus der Schweiz kam, die aufräumte. UND ICH HABE AUFGERÄUMT. Dealen, Rauschgift – so etwas kam auf meine Rote Liste!»
Wie hast du das alles auf die Reihe gekriegt – ich meine: Du hast den Laden ja übernommen. Und daraus einen Szenen-Treff Berlins gemacht.
«Nun – mit meinen Filmen und Engagements auf der Bühne – ich schauspielere ja immer noch in Berlin – hatte ich etwas Geld auf die Seite schaffen können. Daneben kellnerte ich hier. Und dann passierte alles auf einmal…»
Wir werden unterbrochen. Eine Türkin betritt das Restaurant. Jennifer umarmt sie. Später vernehme ich, dass die Frau im schwarzen Rock kein Geld hat. Ihr Mann ist im Gefängnis. Und sie holt im «Helvetia» immer das Brot vom Vortag und Essensresten für sich und die Kinder ab.
Jennifer lächelt nun etwas traurig:
«Auch d a s ist Berlin … Kreuzberg … also: Ich hatte damals ein Engagement in der Schweiz. In einer Comedy sollte ich die lustige Schwarze spielen. Während der Proben starb mein Vater. Für mich brach die Welt zusammen. Er und Frutigen waren immer ein fester Halt in meinem turbulenten Leben gewesen.
Ich probte natürlich trotzdem weiter. Das ist ja der Beruf. Aber sie sagten mir, ich sei schlecht. Und setzten mich auf die Strasse … das war ein zweiter Schock, etwas, das mein Selbstvertrauen total zerstörte…»
Was hast du gemacht?
«Ich habe prozessiert. Und den Prozess gewonnen – doch nun kam eine dritte Hiobsbotschaft: Der Besitzer des ‹Helvetia› war am Ende. Und wollte verkaufen. Das durfte einfach nicht sein. Das ‹Helvetia› war meine zweite Heimat. Und so habe ich all mein Erspartes genommen – und in den Laden investiert...»
Schon wurde es ein voller Erfolg…
«…ja, das denkst d u. Meine Freunde halfen mir, das Restaurant zu säubern. Wir malten. Putzten. Verteilten Blumentöpfchen und so … aber die Pinte blieb leer. Wir hatten nicht das erhoffte ‹full house›…»
Also hast du Werbung gemacht?
«Womit? Mein Geld war aufgebraucht. Aber ich hörte, dass Dieter Meier in der Nebenstrasse mit Yello auftreten würde. Also rief ich sein Management an. Ob sie nicht bei uns die Premierenfeier durchziehen wollten? – Die wollten schon. Doch musste ich ihnen zehn Essen umsonst abgeben. Nun – obwohl an jenem Abend dann unser alter Herd auseinanderbrach, wurde es ein riesiger Erfolg. Wir kamen in den Medien. Und das war der Start zum heutigen ‹Helvetia›…»
Jetzt verkehrt hier Gott und die Welt:
«Ja. Nach neun Uhr abends gibts kaum einen freien Platz. Wir haben Leute aus allen sozialen Schichten, aus allen Kunstrichtungen hier. Ich organisiere Konzerte. Und stelle Partys auf die Beine – unser alt Botschafter Tim Guldimann ist Stammgast. Und hat hier seinen Nationalratssieg gefeiert – vor allem aber ‹networke› ich. Denn die Fäden laufen hier zusammen…»
Manchmal jodelst du auch?
«Nun – ich habe schliesslich eine musikalische Ausbildung genossen. Und die Leute lieben das Jodeln. Vor allem wenn wir als ‹Personal-Union› auftreten. Die Kellnerinnen und Kellner sind fast alle angehende Schauspieler – einige wurden hier vom Fleck weg engagiert…»
Du bist jetzt arriviert – wie ist das mit der schwarzen Hautfarbe. Gib es Diskriminierungen?
«Nein. Eigentlich habe ich das nie so erlebt. Als kleines Mädchen in Frutigen wurde ich immer an die Geburtstagseinladungen meiner Schulfreunde eingeladen. Aber niemand wollte mit mir tanzen. Das machte mich traurig. Und meine Mutter tröstete mich: ‹wait a while›.»
«Als ich dann 15 Jahre alt war, stand das Telefon nicht mehr still. Und meine Mutter grinste: ‹you see…›»
Ist der Unterschied an Toleranz zwischen Berlin und der Schweiz sehr gross?
«Überhaupt nicht. Es ist auf der ganzen Welt dasselbe – es gibt stets Menschen, die andere diskriminieren. Ganz krass habe ich das kürzlich in unserem Haus erlebt. Ein Mieter mimte bei meinem Erscheinen immer den Affen. Und sagte, ich solle abhauen und in den Urwald zurück. Als ihn mein Freund zur Rede stellte, schaute er ihn nur eiskalt an: ‹ÜBERLEG SCHON MAL DEINE GRABREDE!›»
Gottlob ist der Fascho ausgezogen!»
Das Telefon surrt. Jennifers Augen blitzen. «Haasi – wie schön!»
Es ist ihr Freund – ein russischer Discjockey.
«Ich geniesse das Leben mit ihm. Er hat eine Tochter. Und ich brauche dieses ‹Familienfeeling› – vielleicht steckt da noch etwas Frutigen in mir.
Als ich meiner Mutter erklärte, ich hätte einen Discjockey als künftigen Ehemann, da reagierte sie etwas weinerlich: ‹Aber Jennifer – we don’t go away to marry a poor man.›»
Sie spielt weiterhin in Filmen – «Highway to Hellas» ist eben angelaufen – in Theaterstücken, im Fernsehen. Aber sie träumt von einer eigenen Sitcom: «Mein Leben hier im ‹Helvetia› …es ist vollgespickt mit verrückten Geschichten wie eine Überraschungstischbombe an Silvester… ich habe einige Szenen auch schon geschrieben… das Ganze würde eine total irre Comedy abgeben…»
Titel?
Sie überlegt – dann lacht sie wieder:
«Hell-vetia».