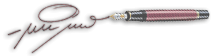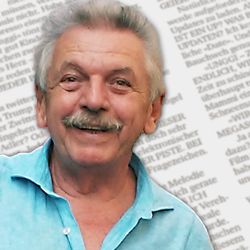Der bekannteste Basler Kolumnist hört auf zu schreiben. Im Gespräch mit der Wochenzeitung DIE ZEIT erzählt -minu, wie der Geldadel in der Stadt seine Macht ausübt, weshalb der FC Basel alle verrückt macht und warum er sich als schwuler Mann nie diskriminiert fühlte.
Das Gespräch führte Barbara Achermann
Das schmale Basler Stadthaus, in dem Minu lebt, ist das Haus eines Gastgebers: Im Erdgeschoss gibt es eine Restaurant-Küche und eine schier unendlich lange Tafel, auf der heute allerlei Gebäck steht, außerdem eine goldene Badewanne, gefüllt mit den besten Pralinen der Stadt. Eigentlich heißt er Hanspeter Hammel, aber alle nennen ihn Minu, als ehemalige Arbeitskollegen duzen wir uns.
Seit 52 Jahren schreibt Minu viel beachtete Kolum- nen in der »Basler Zeitung«, zunächst über den Geldadel, später auch über sein Leben als schwuler Mann. Weil seine große Liebe schwer krank ist und er selber auch schon 74 Jahre alt, will er demnächst mit dem Journalismus aufhören.
DIE ZEIT: Ich erinnere mich an unsere erste Begegnung. Es war Chlaustag, und du kamst mit einem roten Mantel mit weißem Pelzkragen auf die Redaktion der Basler Zeitung, hast deine Hüften geschwungen und eine Show abgezogen.
Minu: Ich genoss solche Auftritte nicht, aber sie wurden von mir erwartet.
ZEIT: Ich dachte, du liebst sie!
Minu: Nein. Und trotzdem spiele ich oft diese Tunten-Rolle, ich hab sie von Fred Spillmann gelernt, er war der bekannteste Schwule, den Basel je hatte. Eines Tages schenkte er mir eine Jokerkarte aus Gold und sagte: Weißt du Minu, uns beide kann man an jeden Tisch setzen, zu den Huren und zu den noblen Herrschaften des Basler Daig. Wir sind wie der Joker, wir passen überall rein. Aber wir gehören nie wirklich dazu.
ZEIT: Ein hartes Schicksal?
Minu: Es hat auch seine Vorteile.
ZEIT: Als Joker kennst du Intrigen und Machenschaften, von denen wir Journalisten oft keine Ahnung haben.
Minu: Aber im Gegensatz zu euch habe ich nie alles aufgeschrieben, was ich wusste.
ZEIT: Trotzdem wurde deine Klatschkolumne aus dem Basler Daig besser gelesen als alles andere in der Zeitung.
Minu: Als ich 1969 die Idee dafür hatte, war die ganze Redaktion gegen mich, das war denen zu wenig intellektuell. Einzig der Verleger war Feuer und Flamme.
ZEIT: Heute ist Stadt in einer Krise. Was ist zum Beispiel los mit dem FCB?
Minu: Der Club war immer schon mehr als nur Fußball. Man ging an den Match, um Leute zu treffen.
ZEIT: Du vielleicht, aber anderen sind die Resultate schon wichtig.
Minu: Mir doch auch! Basel hat halt keinen anderen Sport. Wir sind weit weg von den Bergen, haben keine Skifahrer, kein großes Eishockey-Team. Aber wir hatten schon immer viele Ausländer: Der Elsässer, der Schwabe, später der Albaner, die konnten alle mittschutten. Das schweißt eine Stadt zusammen. Der richtige Kitt kam dann aber mit Gigi Oeri.
ZEIT: Die Roche-Erbin war einige Jahre Club-Präsidentin. Legendär wurde das Bild, als sie sich 2002 nach dem Meistertitel zu den Spielern ins Sprudelbad setzte.
Minu: Die Leute zerrissen sich das Maul über ihren hautengen Anzug, die wichtigen Dinge aber sahen sie nicht: Gigi hat den FCB zu einem Familienclub gemacht. Es beelendete sie, dass die Frauen zu Hause hockten, während die Männer an den Match gingen. Also führte sie den Family-Corner ein, und plötzlich waren auch die Frauen und die Kinder im Stadion. Auch die Nachwuchsförderung hat sie massiv ausgebaut.
ZEIT: Was ist mit dem aktuellen Präsidenten, Bernhard Burgener?
Minu: Er ist das Gegenteil von Gigi. Ihr ging es um den sozialen Moment. Ihm geht es nur um den Stutz.
ZEIT: Es gab ein Großdemo, Fans errichteten ein Mahnmal auf dem Barfüsserplatz, Leute deponierten einen Schweinekopf vor der Geschäftsstelle des FCB, verbrannten eine Burgener-Puppe. Das ist doch übertrieben.
Minu: Das hat keinen Stil und ist nicht tolerierbar. Trotzdem, der FCB ist ein Teil dieser Stadt, ein Kulturgut. Wie die Fasnacht.
ZEIT: Für Basler sind das die drei schönsten Tage im Jahr.
Minu: Wenn du als dummer, dicker, schwuler Junge mit Eltern aufwächst, die vor allem mit sich selber beschäftigt sind, dann ist die Clique ein Familienersatz. Ich fühlte mich nie so geborgen wie am Morgestraich, eingeklemmt zwischen den Fasnächtlern der alten Garde.
ZEIT: Fasnacht als Heimat?
Minu: Ja. Ich habe einen Tamilen interviewt, der als kleiner Bub in einer Clique trommeln lernte und heute Material- und Sujetchef ist. Er sagte: Ich wäre in meinem Leben nie so weit gekommen, wäre ich nicht in einer Clique. Sie hat ihm Selbstvertrauen gegeben. Heute studiert er Informatik.
ZEIT: Wegen Corona wurde die Fasnacht schon zum zweiten Mal abgesagt, die Herbstmesse fand nicht statt, die Uhren- und Schmuckmesse ist tot, der FCB taumelt. Was bleibt dieser Stadt noch?
Minu: D’Chemie. Denn von der Kultur allein kann sie nicht leben.
ZEIT: Roche, Novartis und Syngenta florieren.
Minu: Du kannst aber eine Kuh nur so lange melken, bis sie keinen Tropfen mehr gibt. Die Gefahr ist, dass man in Basel von der Pharma zu viel will.
ZEIT: Zu viel Steuern? Aber Regierungsrätin Eva Herzog, eine Sozialdemokratin, hat doch damals dafür gesorgt, dass die nicht erhöht werden.
Minu: Auch ihre Nachfolgerin Tanja Soland. Die Linken haben einfach gute Frauen!
ZEIT: Die Pharma-Konzerne dürfen Boden für ihren Campus privatisieren und die höchsten Türme im Land hochziehen. Kaum jemand muckt auf.
Minu: Wir sind alle abhängig von der Pharma, und das ist nicht ungefährlich. Das geht so lange gut, wie es bei den Oeris und Hoffmanns keinen Krach gibt.
ZEIT: Die beiden Familien sind Hauptaktionäre von Roche. Zeichnet sich dort ein Zwist ab?
Minu: Das ist wie beim englischen Königshaus: Nichts dringt nach draußen.
ZEIT: In Basel nennt man die High Society den Daig. Wer gehört da eigentlich dazu?
Minu: Der mittlerweile verstorbene Architekt und Nationalrat Martin Burckhardt hat es mir mal so erklärt: Es reicht nicht, viel Geld zu haben und aus einer alten Familie zu kommen. Du musst auch sozial engagiert sein und politisch Einfluss nehmen.
ZEIT: Burckhardt war ein Liberaler, wie viele aus dem Daig. Wie hat er Einfluss genommen?
Minu: Mein Vater war Tramführer und saß für die SP in der Kommission fürs Rollmaterial. Er fand natürlich, Basel brauche neue Trämli. Zur gleichen Zeit hockte Martin Burckhardt in der Kunstkommission und wollte s Füüdle vom Brâncuşi für das Kunstmuseum.
ZEIT: Die Skulptur des Bildhauers Constantin Brâncuşi.
Minu: Die gab es damals zu kaufen, aber die Stadt hätte ein oder zwei Millionen dran zahlen müssen. Die Linken hatten damals noch nichts mit Kunst am Hut. Anstatt dass es einen riesen Krach gab im Großen Rat, kam der Martin zu uns nach Hause und sprach sich mit meinem Vater ab. Sie sorgten dann dafür, dass sowohl die Trämli als auch der Brâncuşi gekauft wurden. Früher nannte man das Mauscheln, und irgendwann fanden es alle schrecklich. Aber ich vermisse diese Deals.
ZEIT: Heute hat vor allem die Familie Vischer – mit Vögeli-V – viel Einfluss in Basel. Es gibt Leute, die sagen, dass das Anwaltsbüro Vischer die Stadt regiere. Die haben an der Basler Verfassung mitgeschrieben, einer ihrer Anwälte, David Jenny, präsidiert das Parlament, ein anderer, Conradin Cramer, ist Regierungsrat.
Minu: Der Daig nimmt nicht nur über die Liberalen Einfluss, die meisten stehen eher links: Dank Bea Oeri hatten wir einige Jahre lang eine alternative Tageszeitung, die Tageswoche. Heute unterstützt ihre Stiftung das Online-Portal Bajour. Maja Sacher schenkte der Stadt das Museum für Gegenwartskunst und ein paar Picassos, ihre Enkelin Maja Oeri baute das Schaulager und finanzierte den Neubau des Kunstmuseums mit.
ZEIT: Wie bist du in diese Kreise reingekommen?
Minu: Durch Hölzli, meinen Partner. Er stammt aus dem zweitältesten Basler Stall.
ZEIT: Christoph Holzach war vor seiner Pensionierung Mitinhaber des Anwaltsbüro Holzach und Partner. Du hast dich aber nicht nur in sein Geld verliebt?
Minu: Ach was. Ich mag sein rationales Denken und den Schalk in seinen Augen.
ZEIT: Neben dem Kolumnen-Schreiben hast du dir ein zweites Standbein als Koch aufgebaut.
Minu: Dabei hasse ich das Kochen – und bin nicht mal besonders gut darin.
ZEIT: Aber du kannst dekorieren.
Minu: Jean Tinguely hat nach dem Essen meinen ganzen Dekokram eingepackt und daraus eine Collage gebastelt. Dort an der Wand hängt sie, die mit den Federchen.
ZEIT: Du bekochst die Leute stets bei dir daheim.
Minu: Manchmal musste die Polizei wegen der VIPs die Straße sperren: Bundesrat Adolf Ogi kam zweimal, der frühere deutsche Bundespräsident Walter Scheel sogar drei- oder viermal.
ZEIT: Künstler, Politiker und Wirtschaftschefs sassen bei dir an einem Tisch. Kam es nie zum Eklat?
Minu: Doch, doch. 1986 zum Beispiel, als wegen des Chemieunfalls von Sandoz der Rhein rot wurde und die Fische starben. Drei Wochen später war unser Essen, eingeladen war unter anderem der Big Boss von Sandoz, Marc Moret, mit seiner Frau. Ich hoffte ja, der habe so viel Anstand und sage ab. Denkste! Ich schwang in der Küche die Kelle und wusste gar nicht, was am Tisch abging. Bis Frau Moret schluchzend in den Armen meiner Hilfsköchin Ginetta lag. Das Paar wurde von den anderen Gästen zur Sau gemacht. Nicht unverdient, schliesslich hat der uns den Fluss vergiftet.
ZEIT: In Basel sieht man es den Leuten ja meist nicht an, dass sie Multimilliardäre sind. Die kamen vermutlich alle mit dem Tram statt mit dem Porsche?
Minu: Und mit dem Gummitäschli am Arm. Me het's, aber me zeigt's nit.
ZEIT: Waren die Leute vom Daig nie sauer, weil du ihren Klatsch in die Zeitung getragen hast?
Minu: Ach was, die haben sich amüsiert. Sauer sind nur die Prokuristen, die Möchtegerne, die nicht drin vorkommen. Jede Woche haben mir Leute geschrieben, ob ich sie nicht bittibätti einmal erwähnen könnte.
ZEIT: Ein wichtiger Anlass war jeweils die Modeschau von Fred Spillmann. Er trat schon in den Dreißigerjahren als Dragqueen auf, war Couturier und kleidete auch Grace Kelly ein.
Minu: Ganz Basel wollte wissen: Wer ist eingeladen? Denn nur die gehörten wirklich dazu. Man musste sich beim Empfang sogar ausweisen.
ZEIT: War Spillmann dein Vorbild?
Minu: Er hat uns Schwulen den Weg bereitet. Während der Fasnacht stand er im Pelzmantel auf der Terrasse des Cafés Spillmann an der Mittleren Brücke. Neben ihm sein Freund, Monsieur Peggy, ein wunderschöner Mann aus Paris. Sie sahen aus wie das Königspaar und ließen mit einem Körbchen Champagner runter für die Waggis. Alle akzeptierten sie, auch mein Vater und seine Trämler-Kollegen. Deshalb ist es mir immer leichtgefallen, schwul zu sein.
ZEIT: Basel war homosexuellen Männern gegenüber also offen?
Minu: So jedenfalls habe ich das erlebt. Basel ist klein, aber es ist nicht eng. Wenn ich am Dreiländereck stehe, spüre ich Rotterdam und das Meer. Mir geht das Herz auf, wenn ich im Elsass über die weiten Felder spaziere. Die Stadt gibt mir ein Gefühl von Freiheit.
ZEIT: Obwohl du die Hälfte des Jahres in Italien lebst?
Minu: Rom ist in mancherlei Hinsicht provinzieller als Basel. Dort tratschen die Nachbarn wie in einem Dorf: »Bist aber spät heimgekommen gestern Nacht.« In Basel ist das den Leuten wurst. Ich wurde hier mein Leben lang nie schräg angeguckt oder diskriminiert, weil ich schwul bin. Meinen Eltern hab ich schon mit acht oder neun Jahren gesagt, dass ich mal mit einem Mann zusammenleben will. Die haben nicht mal mit der Wimper gezuckt.
ZEIT: Das war in den 1950er-Jahren.
Minu: Du hast bestimmt den Film Der Kreis gesehen? Der spielte in Zürich, die Gesellschaft ist wahnsinnig intolerant, die Polizei prügelt auf die Schwulen ein. Ich war auch mal in dieser berühmten Barfüsser-Bar und fand es schrecklich. Das war so eine richtig abgeschottete Szene.
ZEIT: Und in Basel?
Minu: Hier war alles viel offener, toleranter. Polizeigewalt und Repression habe ich nie erlebt. Mit 14 hat mich ein welscher Rekrut vor der Kaserne aufgegabelt. Er zeigte mir alle Museen, aber ich wollte nur bumsen, also nahm ich ihn nach Hause. Am nächsten Morgen beim Frühstück sagte ich meinen Eltern: Ich habe einen Freund, und der schläft oben im Zimmer. Meine Mutter sagte nur: Dann brauchen wir ein zusätzliches Gedeck.
ZEIT: Und außerhalb der Familie?
Minu: Hab ich auch nie ein Geheimnis daraus gemacht. Als mich am Gymnasium der Zeichenlehrer fragte, ob ich eigentlich schwul sei, sagte ich: Ja, natürlich, warum? Ich strickte im Lateinunterricht, noch bevor die Sozis damit anfingen, und puderte mir regelmäßig die Nase. Das hat keinen gekümmert. Ich hatte dann auch ein Gschleipf mit meinem Chemielehrer. Von da an hatte ich alles andere als Schule im Kopf und bin dann leider durch die Matur gerasselt.
ZEIT: Gab es auch Schwulen-Clubs in Basel?
Minu: Klar. An der Mustermesse gab es eine Beiz, die Baslerhalle, dort servierte der Schwingi Hans, im Minijupe, mit roter Perücke und grünen Lippen. Und dann gab es das Isola im Gerbergässchen, wunderschön. Aber ich mochte solche Clubs nie besonders, ich schaue ungern zu, wenn zwei Männer zusammen tanzen, in der Hinsicht bin ich altmodisch.
ZEIT: Deine Mutter machte sich dann doch Sorgen.
Minu: Ich habe richtig rumgehurt. Einmal gabelte ich einen Deutschen auf, der hat mir gefallen, so ein tätowierter Boxer. Ich ging mit ihm auf sein Hotelzimmer am Bahnhof. Im Bett war er dann leider eine Pflaume. Als ich am nächsten Morgen heimkam, standen drei Schmierlappen bei uns in der Küche. Es stellte sich heraus, dass meine Affäre ein Mörder war.
ZEIT: Du bist in einer unkonventionellen Familie aufgewachsen.
Minu: Und ob. Mein Vater war viril, sehr sportlich, sah unglaublich gut aus und hatte immer viele Affären. Meine Mutter unterstützte ihn darin, denn Sex interessierte sie nicht. Sie war froh, dass sie das an ihre Freundinnen delegieren konnte. Sie managte Vaters Liebschaften: »Du warst schon letztes Mal mit dem Trudi in den Ferien, jetzt musst du mal eine andere zum Zug kommen lassen.« Sogar ihre eigene Schwester, die ein paar Jahre bei uns wohnte, war seine Geliebte.
ZEIT: Auch politisch waren deine Eltern sehr gegensätzlich.
Minu: Meine Mutter kam aus einem guten Stall, sie war im Herzen eine Liberale und hat ihr Geld geschickt an der Börse vermehrt. Damit kaufte sie sich dann mal bei Fred ein Kleid, für 15.000 Stutz. Das brachte meinen Vater auf die Palme: Weißt du, wie viele Arbeiterfamilien man mit der Kohle ernähren könnte? Er war Trämli-Chauffeur, ein Linker von der alten Sorte, Gewerkschafter und später SP-Großrat. Lustigerweise glichen sie sich aber im Alter an: Er wurde immer rechter und sie immer linker.
ZEIT: Viele Arbeiter fühlten sich bei der SP irgendwann nicht mehr zu Hause. Ging ihm das auch so?
Minu: Ich war vielleicht 23 Jahre alt, als ich nach Hause kam und ihn zum ersten Mal weinen sah. Er sagte: Ich verstehe meine Parteifreunde nicht mehr, die sprechen so gescheit. Es war die Zeit, als die sogenannten Intellektuellen in die SP kamen. Später wechselten dann einige von Vaters Parteifreunden zur SVP. Das war ein harter Schlag für ihn.
ZEIT: Du selber konntest nie etwas mit Parteipolitik anfangen.
Minu: Überhaupt nicht. Wenn du als Kind bei jedem Essen mitanhören musst, wie über Politik gestritten wird, verleidet es dir. Aber ich habe mich für Ausländer engagiert und zusammen mit Hölzli für die eingetragene Partnerschaft.
ZEIT: 2007 wart ihr eines der ersten Paare, die sich auf dem Amt eintragen ließen.
Minu: Wir wollten nur kurz unterschreiben. Aber jemand hat geplaudert, es stand eine Kutsche vor der Tür, eine riesige Menschenmenge und das Fernsehen. Furchtbar.
ZEIT: Ganz Basel schwelgte, wenn du deinem Hölzli in deiner Kolumne mal wieder die Liebe gestanden hast. Eure Beziehung ist bis heute auch für viele Heteropaare eine Projektionsfläche.
Minu: Mag sein, aber wir hatten keine Lust auf die Hochzeitskutsche. Ich saß eine Stunde später beim Zahnarzt und Hölzli hatte einen Termin mit einem Klienten.
ZEIT: Du bist seit 52 Jahren mit deinem Partner zusammen. Würdest du ihn gern richtig heiraten?
Minu: Nein, wir sind zu alt dafür. Aber früher hätte ich mir das sehr gewünscht.
ZEIT: Mitte April wurde das Referendum gegen die Ehe für alle eingereicht.
Minu: Ich verstehe diese Leute nicht, sie machen mich sauer. Die Ehe müsste doch ein Grundrecht sein – für jeden.
ZEIT: Für einmal fühlst du dich also doch diskriminiert?
Minu: Ja, natürlich.
ZEIT: Du hast in deinem Leben schon viele Tabus gebrochen. Das letzte vor wenigen Jahren, als du öffentlich gemacht hast, dass du dich mit HIV angesteckt hast.
Minu: Warum sollte ich daraus ein Geheimnis machen? Aber das große Tabu war nicht HIV, sondern dass ich mit 70 noch Sex habe. Die Leute wunderten sich: Was, in dem Alter!
ZEIT: Wie hat dein Partner reagiert?
Minu: Besorgt, aber wütend war er nicht. Wir hatten immer eine offene Beziehung, haben uns beide sexuell ausgetobt. Aber Hölzli ist zwölf Jahre älter als ich, seit einigen Jahren schmusen wir nur noch.
ZEIT: Du hast in den 1980ern Kondome auf der Straße verteilt und für Safer Sex geworben. Wie konnte das ausgerechnet dir passieren?
Minu: Es war dumm von mir, keinen Gummi zu nehmen. Ich wusste, dass der Mann positiv ist, wir sind alte Freunde, haben immer wieder miteinander gevögelt, aber er hat mir verschwiegen, dass er seine Pillen nicht genommen hat. Deshalb war er ansteckend.
ZEIT: Wie hast du gemerkt, dass du dich angesteckt hast?
Minu: Schon zwei Tage später hatte ich Fieber, Schüttelfrost, furchtbare Halsschmerzen und ge- schwollene Lymphknoten. Ich kannte die Symptome ja noch von den Sterbehäusern, damals hab ich einige Freunde in den Tod begleitet. Also ging ich gleich zu meinem Hausarzt, Felix Marti, der übrigens auch der Arzt des FCB ist. Der kennt sich natürlich bestens aus mit Geschlechtskrankheiten.
ZEIT: Was hat man dir verschrieben?
Minu: Ich muss jetzt täglich eine Pille schlucken, die hat bei mir null Nebenwirkungen. Heute kannst du mit HIV alt werden. Aber ausgerechnet letzte Nacht habe ich aus Versehen zwei Pillen genommen und war hellwach, als hätte ich mir einen Vitamincocktail reingezogen. Ich hab dann die ganze Nacht an meiner BaZ-Kolumne geschrieben.
ZEIT: Kürzlich las ich in deiner Kolumne, dass Hölzli Sachen vergisst. Er ist jetzt 86 Jahre alt. Wie muss man sich euren Alltag vorstellen?
Minu: Es geht ihm nicht gut, wir sind auf der Schlussetappe. Das klingt schrecklich, aber es ist auch schön. Alles ist gesagt, wir wollen nur noch Nähe.
ZEIT: Wie hat sich eure Liebe verändert?
Minu: Sie ist noch größer geworden. Wir brauchen einander. Manchmal streckt er seine knochige Hand aus: »Schön, dass wir einander haben... «Dann gehe ich kurz raus, damit er mich nicht heulen sieht.
ZEIT: Redet ihr über den Tod?
Minu: Ja, oft. Wir haben ein Haus in der Toskana. Im Garten gibt es ein schönes Plätzchen mit Blick aufs Meer. Dort haben wir einen Marmortisch aufstellen lassen, wo wir mal unsere Asche hinstellen wollen. Der Wind soll sie verstreuen. Eigentlich sollte es eine Art Grab sein, doch die Ecke gefällt uns so gut, sie wurde zur Bar. Wir haben zwei Stühle hingestellt und trinken jetzt oft unseren Aperitif dort. Wir nennen es den Aeschenplatz.
ZEIT: Euren Humor habt ihr nicht verloren.
Minu: Im Gegenteil, der wird im Alter immer schwärzer. Kürzlich fragte ich Hölzli, wie ich denn seine Asche über die Grenze schmuggeln soll. Die Zöllner würden doch die Urne bestimmt beschlagnahmen. Woraufhin er sagte, eine Urne ist sowieso viel zu teuer. Pack mich in einen Migros-Sack!
erschienen in DIE ZEIT Schweiz Nr. 20/2021