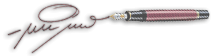Meine Erinnerung: ein grosses geschlossenes Fenster. Die Krankenschwester - ich durfte sie «Schwester Lieseli» rufen - nahm mich auf. Und weit unten auf der Strasse winkte eine Frau zum Fenster. Sie weinte.
«Winke zurück - das ist die Mamma», gab Lieseli den schwesterlichen Befehl durch. Ich kannte die Frau dort unten nicht. Ich winkte trotzdem.
Ein paar Tage später stand mein Vater dort. «Er möchte wissen, was du dir wünschst, wenn du wieder heimdarfst...», gab Lieseli die frohe Botschaft durch. «Einen Puppenwagen. Mit einer Puppe drin...» Schwester Lieseli seufzte. Ging auf die Strasse. Und überbrachte die frohe Botschaft etwas säuerlich dem schönen Vater. Dieser winkte nicht mehr.
Ich musste wieder laufen lernen. Und auch die Namen meiner Eltern. Natürlich erfüllten sie mir den Puppenwagen-Wunsch. Ich sehe ihn noch vor mir: ein Korbgeflecht. Holzräder. Und rote Rüschen. Drin lag ein schwarzes Puppenkind.
Der nächste Spitalbesuch war dann etwa drei Jahre später: Die Mandeln mussten raus! Sie köderten mich mit der grossen Lüge: «Nach der Operation bringen sie dir so viele Glace-Kugeln, wie du haben möchtest...» Meine beiden Bilder, die mir geblieben sind: ein Sennenkäppi. Äthergetränkt. Sie klatschten es mir vor die Nase. Es stank fürchterlich. Und ich sah tanzende Elefanten. Als die Elefanten ausgetanzt hatten, kotzte ich explosionsartig los. Die Krankenschwester war ungehalten: «Dort ist das Becken, du Saubub!» - «UND WO IST DIE GLACE?!» Sie brachten nur lauwarme Vanillecreme.
Damals habe ich gelernt, die Versprechungen der Erwachsenen kritisch zu hinterfragen. Das hat mir später bei Wahlen geholfen, einen klaren Kopf zu bewahren. Immerhin hat mein Vater, als ich nach Hause durfte, beim Bäcker Schneiderhan eine Salatschüssel mit Vanille-Erdbeer-Eiskugeln füllen lassen. DAS DANN DOCH!
Von einem anderen Spitalbesuch taucht das Bild der bleichen Frau mit den langen schwarzen Haaren im Bett vor mir auf. Nach ständigen Koliken wurden meiner Mutter die Gallensteine rausgenommen. Heute zertrümmern sie so etwas. Damals war es eine grosse Sache. Mutter schlief, als wir ins Krankenzimmer kamen. Auf dem Schwenktischchen lagen drei unangerührte Löffelbiscuits. «Ist sie tot?», fragte ich den Vater. «Kann ich ihre Biscuits haben...» Jahrelang wurde das an Familientagen so herumkolportiert.
Von jenem Tag an hatte ich drei, vier Jahrzehnte Ruhe vor dem Spital. Meine Mutter lag wohl über zwei Jahre im Komaschlaf in einem Privatzimmer. Ich habe sie nie besucht. Ich heulte mir daheim den Kopf aus. Ich konnte sie einfach nicht so hilflos daliegen sehen. Ich brachte das nicht über mich. «Ich gehe für dich», sagte mein Vater. Und besuchte täglich das dunkle Zimmer mit dem leblosen Körper.
Am einzigen Tag, als die Gewerkschaftskollegen ihn in Bern zum Ehrenpräsidenten machten und er nicht im Spital erschien, konnte sie in Ruhe sterben.
Das Alter klopft dann plötzlich an. Es hat den Rucksack vollgestopft mit Spitalbesuchen: Ein guter Freund will von dir Abschied nehmen die Omama mag einfach nicht mehr und verweigert jede Nahrung... die beste Freundin liegt kalkweiss in den Kissen. Und lächelt: «Wie findest du mein Haar - sag jetzt nichts: ES IST EINE GOTTVERDAMMTE PERÜCKE!» Und du merkst, dass das Schicksal die Spitalbesuche für den Rest deines Lebens ins Tagebuch aufgenommen hat.
Seit einigen Wochen gehe ich zwischen unserem Haus und dem Spital hin und her. Der Weg ist zur Gewohnheit geworden - wie der Gang zur Schule als Bub. Immer wenn ich das «Clara» betrete, sitzt dort eine Katze beim Haupteingang. Einige Leute wollen sie füttern. Sie schaut hochmütig über solche Gesten hinweg. Ich bin nicht der Katzentyp. Hunde sind mein Ding. Aber wenn ich komme, schaut die Mieze auf. Und fixiert mich eine Minute lang. Mehr nicht. Doch ist es wie ein Willkommensgruss. Ein ungesprochenes «Ciao»-Miau. Das tut gut - in einer Zeit, wo selbst die Natur heult.
Ich gehe dann mit Innocent in den grossen Garten, wo die alten Bäume Geschichten erzählen. Wir holen uns beim mobilen Café-Ständchen einen Espresso. Und zwei Butter-Silserli. Plötzlich streicht die Katze Innocent um die dünnen Beine. Er zwickt kleine Stückchen von der Butterbrezel ab. Sie schnurrt. Schmiegt sich an den Rollstuhl. Und lässt sich füttern.
«Gutes Tier!», sagt Innocent. Jetzt schaut sie i h n mit grossen Augen an. Und macht sich davon. Seit jenem Tag steht sie auf, wenn ich morgens ins Spital komme. Sie hat noch immer den langen, prüfenden Blick. Dann macht sie einen Buckel. Und drückt den Kopf an mein Bein.
Und ich weiss nicht, weshalb es mich jedes Mal so traurig macht...
Illustration: Rebekka Heeb