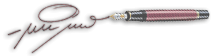Mein Onkel Alphonse gehörte noch zu einer Männergeneration, die herumposaunte: «Wo Hoor isch, isch Freud...»
Für unsere Expats, deutschen Gastarbeiter und Betteltouristen sprachlich umgemünzt: «WO HAARE - DA FREUDE!»
Es war eine Zeit, als Mann noch nicht so schamlos über die Scham redete. Sondern alles durch Aphorismen und Wirtinnenverse verblümelt weitergab. Nun ja. Das hat sich geändert. Auch die Sache mit der «haarigen Freude». Heute: Peeling mit Wachs und Intimrasur mit Frauenschaber - die Mode will, dass man oben wie unten so glatt ist wie eine aus der Stachelschale geschlüpfte Litschi.
Früher taten die Männer alles dafür, ihr Haar zu erhalten. Ich erinnere mich, dass mein Vater reihenweise diese haarigen Stärkungsmittel im Badezimmer stapelte. Er massierte den kostbaren Saft nach jeder Duscherei in den Kopf wie Tante Julchen die Rosinen in den Teig.
ES HALF EINEN DRECK! Die Haare fielen ab, wie die Blätter im Herbst. Und nicht die «Umverteilung der Güter» und eine «gerechte Welt» haben dem alten Sozialisten das Leben schwergemacht: sondern der Haarausfall. Das war das e c h t e Problem.
Mit 40 wurde er halbglatzig. Die Kopfhaut schimmerte durch. Es war der Moment, wo er sich zu einem Schnauzer entschloss.
Der Schnurrbart spross wie eine Frühlingswiese. Und lenkte vom Desaster im oberen Bereich ab.
Da der Schnauzer aber bereits mit Weisshaar gesprenkelt war (Connaisseurs nennen so etwas: «salt and pepper»), griff der Sechsertram-Hans auch hier zum Hilfsmittel: Es hiess «MONTE NEGRO» (wäre vermutlich heute politisch unkorrekt) und wurde als grauer Kleister aus einem Minitübchen auf den Schnauz gestrichen.
Nach einer Viertelstunde Wartezeit und einer zweiminütigen Schnurrbart-Brause mit dieser Lux-Seife, welche damals neun von zehn Filmstars in die Badewanne begleitete, war da plötzlich ein schwarzer Haarwusch. Beim Anblick des Chaplin-Schnauzerchens liess meine gute Mutter vor Schreck ihren teuren «Air du Temps»-Flacon fallen: «RASIER DAS SOFORT AB - DU SIEHST AUS WIE EIN HOSENTASCHEN-HITLER!»
Das Fläschchen und auch Vaters Seele waren zerschmettert. Schnauzer wie Scherben kamen in den Mülleimer. Es war der Moment, wo er damit begann, sein haariges Desaster zu akzeptieren: Er knüppelte vier Knoten in sein baumwollenes Taschentuch. Und trug dieses künftig als Kopfschutz auf Wanderschaften und auch beim Operettenbesuch als Ersatz zur Trämler-Mütze. Letztere gab allerdings bedeutend mehr her. Uniform ist Uniform. Auch wenn nicht viel daruntersteckt.
In der Familie ging die Sage, mein Vater sei ganz und gar auf die Haare meiner Mutter abgefahren. Die waren lockig. Schwarz wie Teer. Und von einer Fülle, dass man nach dem halben Schnitt zehn Matratzen damit füllen konnte...
Das Mutterhaar war eine Erbangelegenheit. Schon meine Ur-Muhme trug die Locken bis zu ihrem Tod kniekehlenlang.
«Richtig bürsten ist das A und O», kämmte sie ihren Töchtern ein. Setzte sich vor ihren Toilettenspiegel. Und strich sich mit diesen ziemlich heruntergewirtschafteten Stummeln, die aus einem Jugendstil-Griff barsten, energisch durch die Mähne.
Auch die Omama hatte nicht nur Haare auf den Zähnen - sie türmte ihren ellenlangen Zopf zu einem riesigen Turm auf. Befestigte das Ganze stundenlang mit Nadeln und kleinen Kämmen. Sie war somit der hochgesteckte Ärger meines klein gewachsenen Vaters, der in der Theaterloge hinter der Schwiegermutter sitzen musste: «Da können sie ja auch das Schreckhorn vor mir aufbauen», jammerte er im Vier-Knoten-Look bei seiner Gattin. Sie reagierte cool: «Danke dem Herrgott, dass sie dich vor dem Publikum abdeckt!»
Für die Haarpflege der Weiblichkeit unseres Clans reichte allerdings die pure Bürsterei nicht. Da wurden Zaubermittelchen verwendet, auf welche die Omama schwor: «Ich klatsche mir stets ein Ei ins Haar, wenn ich sie gewaschen habe.»
Meine Mutter hingegen spülte ihre Locken mit Bier ab. WAR JETZT NICHT SO MEIN DING! Sie duftete wie ein Hofbräuhaus. Natürlich übersprühte sie die starken Wolken mit dem erwähnten «Air du Temps». Es war jedoch gar keine ideale Verbindung.
Als ich Innocent zum ersten Mal traf, ging es mir wie Vater, als er seine Carlotta entdeckte: «Dieses Haar!» Natürlich wollte ich das Geheimnis wissen. «Ich wasche es nur alle 14 Tage!», strahlte er, «...und nach der Waschung kommt ein Eigelb drauf!»
Ich habe daraufhin die Ladung einer ganzen Hühnerfarm auf meine Locken gedonnert. Die Pracht dünnte sich mit den Jahren trotzdem aus.
Heute versuche ich, das wenige mit kunstvollen Kniffen zu strecken. Ich verteile die Strähnen in alle Richtungen, lege sie über die kahlen Stellen und versuche, auch hin und wieder effektvolle Fülle zu toupieren.
Alles umsonst.
Ich komme nach meinem Vater. Und werde wohl bald einmal zum Taschentuch und den vier Knoten greifen müssen.
Illustration: Rebekka Heeb