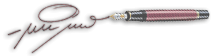«In eigener Sache schreibt man nicht.» – Innocent rümpft die Nase. «Schon gar nicht in die Zeitung!» Der alte Meckerheini hat wieder mal seine vornehme Stunde. Okay. Eigentlich wolle ich nur berichten, wie es zu den Mimpfeli gekommen ist. Sie sind jetzt auf die Stunde genau 40 Jahre alt. UND ICH MEINE, DA DARF MAN DOCH SCHON MAL WEIHRAUCH SPRÜHEN…
«Journalisten, die über sich selber schreiben, sind das Letzte!», legt Innocent noch einen drauf. Da hat er sicher recht. Aber es ist heute eine Zürcher Mediensitte geworden, dass jeder Schreiber über den andern schreibt: Der Journalismus dreht sich so im Kreise. Vielleicht weil nur noch Journalisten Zeitung lesen? Und der Klatsch unter Journalisten über Journalisten von Journalisten das Waschweibergeschwätz der höheren Weihen ist.
ICH WEISS ES NICHT. Ich weiss nur, dass ich gerne mehr über Kolleginnen und Kollegen von mir geschrieben hätte. Dass dies aber immer mit einem Riesengeschrei auf der Redaktion abgewürgt wurde: «DU HAST DOCH EINEN KNALL. SO ETWAS IST UNFEIN. UND UNPROFESSIONELL. DAS EINZIGE, WAS DIE LEUTE INTERESSIERT, IST POLITIK…»
Ach ja? Und weshalb sind denn die Wahlbeteiligungen so mies? Hingegen stürzt sich jeder heissgeil auf harmlose SCHLAGZEILEN und TITELGESCHICHTEN wie etwa, wenn Beni Thurnheer zum 20. Mal seinen Abschied von der alten Frisur feiert. Oder wenn eine Wettertante schwanger ist.
OKAY. AUCH AUF DAS RISIKO HIN, DASS ES NICHT COMME IL FAUT IST: Das Mimpfeli ist 40 Jahre alt. Punktum. Innocent kanns nicht lassen: «Das zeigt nur, wie alt du bist… da nützen auch drei Nivea-Lifting-Tuben nichts mehr…»
Man muss den Dreck des Alltags einfach ignorieren. Und sich an den schönen Momenten der Woche freuen (Goethe?). Deshalb: Türe zuknallen. Und schreiben. Jetzt redet man also von Kolumnen. Glossen. Essays. DAS TÖNT WUNDERBAR. UND ERHABEN. Ganz anders als damals in der alten National-Zeitung, wenn Lokalredaktor Fritz Matzinger (den wir einfach Onkel Fritz nannten) in Panik geriet. Und total entnervt vor meiner Hermes-Hackmaschine herumhampelte: «Wir haben zu wenig Stoff für Seite 6. Mimpfele hurtig ein Geschichtlein…»
Er sagte nicht «Kolumne». Er nannte es «GESCHICHTLEIN». Und er brauchte das Verbum «mimpfeln». Letzteres im imperativen Modus. Onkel Fritz wusste nicht, dass er mit dem Wort Geschichte im Journalismus schreiben würde.
Ich erdichtete also hurtig eine Ente. Sie hiess Gwendolyn. Und sie ernährte sich auf meinem Balkon von Zuckerschnecken. Weil aber schon damals alles Erfundene nur Chancen zum Druck hatte, wenn es auch eine linke politische Aussage enthielt, war Gwendolyn ein Federvieh der anarchistischen Art.
«Umshimmelswillen – was mimpfelst du da wieder zusammen!», verdrehten die Redaktoren die Augen. In den Sitzungen zerrissen sie Gwendolyn, dass die Federn flogen. Und eines Tages änderten sie meine 189. Enten-Geschichte eigenhändig um: Sie würgten den Originalschluss ab und liessen den armen Vogel à l’orange servieren. DAS WAR WOHL DAS ENDE DER ENTE. ABER NICHT DER MIMPFELI.
Mein damaliger Verleger erschien ebenfalls vor meiner Schreibmaschine. Er hatte rote Augen. Sprach mir sein Beileid aus. Und meinte: Ihm habe der anarchistische Enterich immer gefallen. Dass man ihn jetzt einfach so verbraten habe, sei eine schreiende Schande. Seine Frau leide wegen des brutalen Mords an schlaflosen Nächten. Sie habe immer nur dank der Gwendolyn-Geschichten gut schlafen können. Ob ich nicht etwa Neues «mimpfeln» könne? Auch er griff zum Wort «mimpfeln». Und so wurden es dann die Mimpfeli.
Wir waren damals nur ganz wenige Schreiber, die «ganz einfach so Geschichten» aus ihren dicken Fingern sogen. Bei der Konkurrenz, in den Basler Nachrichten, hiess die Geschichtenerzählerin Aebersold. Maria Aebersold. In unserer Stadt war sie ganz einfach als «Myggeli» ein Begriff. Schon als Schüler habe ich ihre Bücher verschlungen. Ihr Schreibstil – knapp. Witzig. Abgerundet. Und alles immer ein bisschen skurril – so etwas faszinierte mich.
Als wir uns dann an einer Pressekonferenz des Zolli begegneten, wars «Liebe auf den ersten Blick». Myggeli schrieb zwar für die Konkurrenz. Aber sie war das Beste, was die Medien damals zu bieten hatten. Die Menschen hingen an ihren Zeilen. Nur die Redaktoren merkten es nicht. Sie lächelten von ihren hohen Stühlen auf die kleine Schreiberin herab: «Ja, ja – das Myggeli. Es ist schon recht», sagten sie. Es gibt wohl nichts Despektierlicheres, als wenn jemand nur «schon recht» eingestuft wird. Die Herren (damals: nur Herren) schlossen sich in ihren Büros ein, um schriftlich darüber zu brüten, wie man die Welt wieder in Ordnung bringen könnte.
Keiner hat ihre Ergüsse je gelesen. Aber die Geschichten von Myggeli, die zogen die Leser rein wie flüssigen Honig.
Als Maria Aebersold einen runden Geburtstag feierte, wollte ich über die Schriftstellerin einen Artikel schreiben. «Was die macht, ist keine Literatur», wehrte der damalige Feuilletonchef entsetzt ab. Er litt an Koliken. Und nahm Tropfen. Aber er hatte sich irgendwann mal den Doktortitel geholt. Und Maria Aebersold nicht. Ich weiss noch, dass ich den überheblichen Redaktor mit «für mich sind Sie ein bornierter Armleuchter» aus der Fassung gebracht habe. Ich sagte natürlich nicht «Armleuchter». Mein Wortschatz hatte Deutlicheres im Köcher.
Maria Aebersold hatte keinen Doktortitel. Aber sie sprach fliessend fünf Sprachen – darunter auch diejenigen der Niederländer und der Sangi-Inseln. Immerhin hatte sie zehn Jahre mit ihrem Mann, der Missionar und Gelehrter war, auf dem indonesischen Archipel verbracht. Sie lebte weitab vom Schuss im Busch. Hat dort ihre drei Kinder ohne Arzt oder Hebamme zur Welt gebracht. Und sich die Geschichten der Insel-Ältesten angehört (später hat sie diese zu wunderschönen Erzählungen verwoben).
Sie spann weit weg von der Heimat grossartige Mimpfeli aus ihrer Kinderzeit. Und über Basel.UND DANN KOMMT SO EIN KULTUR-DIKTATOR UND VERKÜNDET: «Was die macht, ist keine Literatur!»
SCHON DAMALS HABE ICH MICH GEFRAGT: WER ENTSCHEIDET EIGENTLICH, WAS KULTUR IST? Ein Redaktor, der es nie weiter als bis zu einer Flasche Rosé in einem Bistrot in der Provence gebracht hat. Und meint, das sei die Welt der Intellektuellen … Oder eine Frau, die wirklich lebt. Und dieses Erlebte in ihre eigene Sprache verpackt? Nun gut – das war vor einem halben Jahrhundert. Als es noch keine Kolumnisten gab. Und auch keine Slam-Poeten oder Comedy-Entertainer. Sondern nur Geschichtenerzähler. Und Mimpfeler.
1960 erhielt die Schriftstellerin (wie sie heute selbst von strengen Kulturredaktoren genannt wird) den Kunstpreis ihres Heimatorts Binningen. Immerhin. An einem Neujahrstag 1982 ist Maria Aebersold für immer eingeschlafen. Nicht aber ihre Geschichte. Und ihre Geschichten.