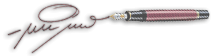Als ich Lale Andersen interviewte war ich neun Jahre alt. Und sie 51.
Damals schrieb ich eine Klassenzeitung. Absolut Klasse. Das Jahres-Abo kostete fünf Cola-Frösche. Meine Mutter war die einzige Abonnentin. Meine Schulklasse interessierte sich nur für Fussballbilder. SO VIEL ZUM THEMA: PRINTMEDIEN HABEN ES SCHWER. SIE HATTEN ES DAMALS SCHON.
Lale Andersen trat im Saal des Restaurants Sanssouci gleich hinter der Basler Stadtgrenze in Allschwil auf. Das «Sanssouci» war berühmt für seine Schinkenbrote. Sowie für eine Serviertochter, die Rosa hiess. Und sich zwicken liess (O-Ton meines immer zugreifenden Vaters).
Jedenfalls gab die Andersen in diesem Sandwich-Schuppen ein Konzert. Und «du gehst nicht zu dieser Schlampe!», nervte sich die Kembserweg-Omi, «sie hat für ihre Karriere Mann und drei Kinder verlassen!»
Der Vater schüttete noch einen drauf: «Sie war ein Hitler-Weib! Wehe ich treffe dich dort…» Lief mir alles kalt am Arsch vorbei. Ich machte mich mit Block und Bleistift auf den Weg. Und war erschlagen vom dunklen, tristen Saal, in dem es nach abgestandenem Bier und viel Stumpenrauch roch. Die blauen Samtvorhänge hatten Risse. Vorne, auf der Bretterbühne, stand diese blonde Frau am Klavier. Sie schaute ratlos zum Pianisten, (der sich als ihr Mann herausstellte): «Arthur – sind wir hier richtig?» Als ich auf sie zuwedelte, lächelte sie etwas verwundert: «Machst du hier das grosse Licht?!» Ich war auch damals sicher nicht das, was man ein grosses Licht nennen könnte: «Ich bin der Journalist, der sie interviewen soll…», bekannte ich demütig. Lale Andersen zuckte zusammen. Sie hatte viele Rückschläge in ihrer Karriere erlebt. Viele Missverständnisse. ABER DAS HIER MACHTE DER SÄNGERIN DAS MIESE SO RICHTIG BEWUSST.
«Magst du ein Cola?», lächelte sie. Dann hockte sie sich mit mir an einen der Holztische. Und strich sich die blonde Haarsträhne nach hinten: «Weisst du, wie man Andersen schreibt?»
15 Jahre später wurde ich auf die grossen Promis dieser kleinen Show-Welt losgelassen. Es war immer gross. Und es war immer Show. Ruedi Reisdorf trommelte damals für seine Benefiz-Galas Namen wie Gene Kelly, Mireille Mathieu, Peter Ustinov, Kulenkampff, Sinatra und die Rothenberger auf die Muba-Bühne. Pfleghar inszenierte die Shows. Ich musste sie alle dem Leser vorstellen. Und schon bald einmal merkte ich: Je grösser die Nummer, desto unkomplizierter der Mensch, der dahinter steckt.
Am schlimmsten waren die Newcomers. Sie waren die Neureichen unter dem alten Showadel. Und sie drehten das Pfauenrad. Kamen zu spät. Inszenierten sich fürs Bild. SIE WAREN WIE SCHNELL HOCHGEZÜCHTETE TOMATEN – FADE. UND OHNE GESCHMACK. ABER AUCH DARAN GEWÖHNTE MAN SICH. UND LERNTE, WIE MAN SIE WEICHZUKOCHEN HATTE …
Manchmal waren die Szenen grotesk. Zarah Leander gab ihre unwiderruflich letzte Abschiedstournee. In Basel gastierte sie im Fauteuil. Rolli Rasser rief an: «Also. Natürlich kannst du die Leander interviewen. Aber Zarah hat jetzt ein stattliches Alter. Und du musst sie mit Samthandschuhen anfassen – ich vertraue dir. Sie hat sonst alle Interviews abgelehnt…» Frau Leander sass dann in dieser Garderobe, die nicht grösser als eine Schuhschachtel war (und auch heute noch nicht grösser ist). Sie war ein Wrack – ein überpudertes Bulldoggen-Gesicht, das sich hinter einer dunklen Brille mit Gläsern, dick wie Bierflaschenböden, versteckte. Schweigend betrachtete sich die Diva im Spiegel – diese Frau, die Göbbels «Nein» gesagt und tausend Gerüchte um ihre Person gesponnen hatte.
«Frau Leander», flüsterte ich, «ich bin ein grosser Verehrer.» Langsam drehte sie sich vom Spiegel weg. Und prüfte mich lange. Stunden – wie mir schien. Schliesslich hustete sie heiser. Und es tönte wie das letzte Bellen eines sterbenden Hofhunds: «VOM ANDERN UFER?»
Ich versteckte hastig das kleine Goldkettchen unter dem Regenbogen-T-Shirt. Dann seufzte sie: «Ich habe eine riesige Schwulen-Gemeinde – weiss der Teufel, was die an mir sehen!»
In diesem Moment polterte Hans Bertolf, der damalige Fotograf mit seiner Hasselblad am dicken Ranzen die schmale Wendeltreppe runter: «ALSO HIER UNTEN KANN ICH DIESE ALTE NICHT FOTOGRAFIEREN!»
Damit war das Interview zu Ende.
Noch peinlicher war die Begegnung mit Maria Becker. Sie spielte im römischen Theater von Augst. Und nach der dritten Frage stand sie auf: «Sie haben ihre Schulaufgaben nicht gemacht, junger Mann. Kommen Sie besser vorbereitet, wenn Sie eine Maria Becker interviewen…»
Ich schämte mich wie ein Hund. Und als ich sie dann Jahre später in Dürrenmatts «Alter Dame» am Schauspielhaus interviewte, meinte sie zum Schluss. «Kennen wir uns nicht?» «Nein», sagte ich.
Lale Andersen schenkte mir von der Cola ins Glas ein: «Weisst du, wer ich bin…?»
«EIN GROSSER STAR», strahlte ich, «UND WENN SIE HIER AUF DEM BLOCK UNTERSCHREIBEN WÜRDEN, LIEBE FRAU LALE…»
Erst viele Jahre später habe ich Näheres recherchiert: Wie ihre «Lili Marleen» ein Welthit wurde…, dass sie mit dem Komponisten gestritten habe, die Background-Sänger würden tönen wie ein Transenchor … und dass das Soldatenlied plötzlich als «ungeeignet» von Göbbels verboten wurde.
Fassbinder hat dann einen Film über Lili Marleen gedreht. Mit Hanna Schygulla. «Das Ganze hat mit ihrem wirklichen Leben nichts zu tun», sagte Arthur Breul, ihr Schweizer Ehemann, später. Hier im «Sans-Souci» hatte er gar nichts zu sagen. Nur auf dem Klavier zu spielen.
1971 traf ich Lale Andersen noch einmal in Wien. Sie war Gast in einer Buchhandlung am Graben. Ihre Biografie «Der Himmel hat viele Farben» stand auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Und als ich ihr das Buch für die Signatur hinstreckte, schaute sie kurz hoch. Lächelte. Und schrieb ihren Namen auf die erste Umschlagseite. Ein Jahr später starb sie.
Das Buch habe ich an Olga, einen Transvestiten, der die Andersen als Lili Marleen parodiert, verschenkt. Ihre Unterschrift, die Lale Andersen mir für meine Klassenzeitung im Saal des «Sanssouci» auf den Block geschrieben hat, habe ich immer noch.
Doch, was ich sagen wollte: Heute machen die Stars Geschichten. Aber sie haben keine mehr…