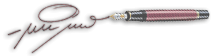«Jambo ... Jambo»‚ diesen Gruss, der nach englischem Haarwaschmittel und französischem Schinken tönt, bekommen wir auf Sansibar landauf, landab immer wieder zu hören. Natürlich jambonieren wir zurück. Es ist immer schön, ein bisschen die Sprache der Einheimischen mitzuplaudern. Unser Sansibar-Hausmeister erklärt uns am dritten Tag dann allerdings, dass dieses «Jambo» ausschliesslich bei Touristen zum Zug komme. Oder bei Menschen, von denen man animmt, dass sie nur ganz schlecht oder gar kein Kiswahili sprechen.
NA WUNDERBAR.
Wir grüssen jetzt immer mit «Servus». Oder «Hello». Und schon geht in den Gesichtern das strahlendste Lächeln dieser afrikanischen Welt auf: «Hakuna Matata.» Immerhin‚ dieser Spruch steht für alle. Und ist Swahili. Er bedeutet so viel wie «null Problem». Oder «alles in Butter!»
Das Leben auf Sansibar ist wirklich Bilderbuch – allerdings nur für Menschen, die sich Hamol-Stellung im weissen Sand und gegrillte Hühnerbrüstchen leisten können.
Der dunkle Rest ist ein Leben an der Armutsgrenze: Buschhütten, die früher mit Schilfriet gedeckt wurden und auf denen heute Wellblech rostet. Irgendwo grast immer eine Ziege, mit herausstehenden Rippen und alles so mager, dass jeder unwillkürlich an Pariser Mannequins denkt.
DAS WUNDERBARE ABER: das Lachen. Männer, Frauen, Kinder – sie sind hier wie eine sanfte, warme Dauerbrause.
Tatsächlich scheint es kaum Probleme zu geben – Hakuna Matata. Auf den Strassen gaggern Hühner. Polizisten pennen unter Mangobäumen. Und die Frauen haben immer etwas zu wischen oder waschen. Aber sie singen. Lachen. Strahlen. Es ist, als hätte man sie in regenbogenfarbigen Happiness-Sirup eingetaucht – und bestimmt würden ihnen unsere ernsten Morgengesichter im Sechsertram wie feuchte Essigstrümpfe vorkommen.
Innocent muss Haare lassen. Wörtlich. Diese prächtigen, üppigen Haare, um die ihn alle beneiden, sind jetzt ein arger Minuspunkt. Bei 42 Grad im Schatten brüllt er nach einem KURZSCHNITT: «Aber nicht hier im Busch ... ich will in die Hauptstadt!» Selbst Zuris zuvorkommender Preis von acht Cents samt Kopfmassage und die tausendfache Beteuerung, er habe allen seinen zwölf Kindern die Haare immer selber geschnitten, lassen Innocent nicht wanken: «Lieber werfe ich 20 Cents auf und gucke dann anständig aus der Wäsche. In meinem Alter ist das Haar noch das einzige Kapital, um bei Weibern zu punkten!»
Hakuna Matata!
Zuri holt Ubwa aus dem Nachbardorf. Er ist der Einzige, der hier ein Auto fährt. Und er will uns für «n Appel und n Ei», wie er stolz auf Deutsch erklärt (er hat fünf Jahre in Berlin als Tellerwäscher ein tansanisches Vermögen herangespült), er will uns also preisgünstig nach Stonetown an den Hafen fahren. Dort wirke Abfalla in seinem Saloon.
Ubwa kann ein paar Brocken Englisch, ein paar Brocken Deutsch‚ na ja: Er ist ein frohes Müesli an Sprachen. Von jeder ein Löffelchen.
Wie Innocent dann Abfallas Bude sieht, wird er doch sehr still. Und ein bisschen käsig: «... und wenn er mir Zöpfchen flicht?»
Ich drücke ihn an mich und sage, Zöpfchen seien genau das, was mir bei ihm stets gefehlt habe. Dann überlassen wir den helvetischen Babu dem tüchtigen Abfalla und einem Coiffeurstuhl, der mal ein Traktorsitz war.
Ubwa führt mich mittlerweile in der kleinen Hafenstadt herum. Hier haben einst die Araber geherrscht. Man siehts an den alten Toren und den maurischen Fenstern.
Vor einem einstigen Krankenhaus machen wir halt: «In diesen Keller wurden die letzten Sklaven von Afrika eingesperrt. Sansibar war immer ein Umschlagplatz der Sklaverei ...» Der Keller ist heiss. Nieder. Und dunkel. 50 Menschen waren an Ketten gebunden worden. Sie konnten kaum atmen. Ubwa sieht, dass mir schlecht wird. Er bringt mich an die frische Luft: «Die Araber haben den Sklavenhandel auch nach 1875 illegal weitergeführt‚ obwohl ihn die Engländer verboten hatten ...» Dann zeigt er mir das Denkmal, das an jene Zeit erinnert: Hinter der englischen Kirche wurde in einem Garten ein grosses Grab ausgegraben. Eine Künstlerin hat schwarze Figuren aneinander gekettet. Ich muss etwas trinken. Mir ist noch immer schlecht.
«Komm‚ wir gehen zu Freddie Mercury», versucht Ubwa mich wieder auf die Reihe zu kriegen. Mercury? Die grosse Callas der Schwulenoper? Die Queen aller Queens? Ubwa nickt: «Seine ersten zehn Jahre hat er hier gelebt. Er hiess eigentlich Farroukh Bulsarain. Bald kam er nach England ins Internat. Seine Vorfahren waren Parsen, aus Iran. Er kam nie mehr hierher zurück ‚ obwohl er vermutlich der berühmteste Sohn dieser Insel ist ...»
Wir stehen nun vor dem Mercury-House. Hier kann man alle CDs der Queen, Bilder, T-Shirts mit einem aufgeschminkten Freddie darauf erstehen. Das Geschäft blüht. Die Leute stehen Schlange. Alle wollen das Geburtshaus knipsen.
Ubwa schaut traurig: «Es ist eigentlich grotesk. In Tansania herrscht noch immer krasser Schwulenhass. Ugandas Kampftrommel ‹KILL THE GAYS!› ist auf viele offene Ohren gestossen. Gay people haben hier kein Brot. Und doch ist es ausgerechnet einer der grössten Schwulen, welcher dem Land das Brot bringt ... die Tourismus-Flut in Stonetwon ist grösstenteils Mercury zu verdanken.» Hakuna Matata.
Wir gehen zu Abdalla zurück. Innocent hockt vor dem Salon. Er lacht nun genau so sonnig wie die Menschen hier: «Abdalla hats für zehn Cents gemacht‚ aber ich habe ihm 15 gegeben!»
O.k. Es sind keine Zöpfchen geworden. Aber Innocent hat nun auch kein Haar mehr auf dem Kopf. Alles wegrasiert.
«Ein wunderbares Gefühl‚ so frisch. Und jung! Ich verstehe jetzt all diese Glatzmännerköpfe ...»
«Wie bekomme ich so etwas bei der Ausreise durch den Zoll», flüstere ich zu Ubwa.
Der: «Pole... pole...» Auch das ist hier so ein immer wiederkehrendes Alltagswort. Es bedeutet: «Langsam... langsam... alles wird gut.»
Na dann: Hakuna Matata.