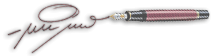Die Frau am kleinen Holztisch wippt mit den Füssen. Sie trägt Ballerina-Schläppchen in der rosigen Farbe von welken Pfingstrosen. Das schüttere Haar fällt ihr in dünnen, teerschwarz gefärbten Strähnen auf eine weissliche Spitzenbluse. Letztere ist für immer dahin: Denn auch der rabiateste Meister Riese kann den Gilb der Jahrzehnte nicht mehr rauszwingen.
Vor dem Runzelpüppchen liegt eine Herbstkugel – die Wiener Spezialität des Novembers: ein Schneeball aus Schlagobers, glacierten Kastanien und Zuckersirup.
Es ist nicht nur eine Wonnekugel – es ist auch eine Kalorienlawine.
Ich gucke neidisch auf das zarte Persönchen, das sich jetzt sorgfältig mit einer Papierserviette den Restrahm aus dem Mundwinkel tupft. Das ausgemergelte Mädchen streicht die dünnen Lippen nach. Scharlachrot.
«Stoffservietten hooms kaane mehr» – wispert das grazile Weibchen, das ein bisschen an eine Porzellan-Primaballerina erinnert. Eine zerbrechliche Musikdosen-Tänzerin, welche die Regie vor 100 Jahren in den Kulissen vergessen hat. Und die langsam zum Staubfänger wird.
Nun – ich bin ein anständiger Mensch. Nicke freundlich. Und zeige auf die Nase, wo immer noch ein weisses Sahnetupferchen liegt.
Madame wiederum bleibt 145 Zentimeter ganz grosse Lady: Sie tupft die Bescherung mit der Serviette weg (die zeigt nun scharlachrote Lippenstift-Spuren, wie frisches «Tatort»-Blut im Schnee). Dann brummelt sie: «Zumindest d Schneekugaln mochen s noch…»
Ich verkneife mir stoisch eine der Schneekugeln, und das alte Mädel folgt meinem sabbernden Blick, der zum Rest auf ihrem Teller giert.
«Solltens schon noch probieren, ehs zu spät ist – schaun Si sich ummi… S isch gor nix mehr wie zu Kaiserszeit … und so ne Schneekugel wird au baldi aus der ‹Demel›-Karten wegrolln…»
Wo sie recht hat, hat sie recht.
Wien ist zwar heller, fröhlicher und jünger geworden. Zumindest ist es heute zuckerstangenbunter als zu jener graudüsteren Zeit, wo meine Mutter hier Ende November Friedhöfe abgeklappert hat. Und an berühmten Gräbern heulte.
Doch irgendwie ist bei der heutigen Hektik die Gemütlichkeit zur Sau gegangen.
Das mit den Friedhöfen war so: Mama liebte einen Bass-Bariton. Der Basler Sänger Ruedi Mazzola hatte sie schon im alten Theater zum Vibrieren gebracht. Weniger der Mann – vielmehr dessen prachtvolle, tiefe Stimme.
Und als Sänger Mazzola dann eine Berufung an die Staatsoper bekam, wurden unsere Schoko-Einkäufe für Weihnachten nicht mehr im Warenhaus Epa Unip getätigt. Sondern an die schöne blaue Donau verlegt.
Schon damals hiess Mutters Credo: «Sie singen nicht nur besser – sie machen auch die besseren Törtchen.»
Immer zu Beginn der Vorweihnachtszeit fuhren wir also hin. Ellenlange Zugfahrten. Aber auch ellenlange Vorfreude: auf Rudolfs Lieder am Grab (Mutter). Und auf Sahnetorten im «Demel» (das Kind).
Mein Vater liess seine Angetraute frohen Herzens ziehen. Denn: Fesseln los. Bude frei. Schon sang er den Vogelhändler auf den Biertischen des «Hopfenkranz». Und beendete die Arie im heimischen Schlafzimmer (dessen vakante Bettseite es neu zu besetzen galt).
Ich war damals noch ein kleiner, allerliebster Junge.
DIESES KIND WURDE ABER MITTEN IN WIEN ALLEINE GELASSEN.
Mazzola zog mittags mit Mutter zum Zentralfriedhof. Der schöne Knabe mit dem Weibel-Kragen und den Simpelfransen wurde im «Demel» deponiert. Dort schauten Servierfrauen mit gestärkten Häubchen und tortenplattengrossen Spitzenschürzen zum lieblichen Buben. Verzog der den Mund und drohte ein Geheul an, wurde ihm sein süsser Kindermund mit noch süsseren Marillen-Cremeschnitten, warmen Apfelstrudeln und Kaiserin-Sissi-Torten verziert gestopft (mit kandierten Veilchen – JA WO GIBTS DENN SO WAS NOCH?).
Die Lippen des Knaben zitterten viel. Und die Konditorenmeister der K. u. K. Bäckerei hatten alle Hände voll damit zu tun, den Schreimund still zu halten.
Mazzola aber sang meiner feinfühligen Mutter an Beethovens Grab dessen ganzen Opus 52 und das Mailied – dies im tiefsten November!
Wenn der Friedhofführer und Staatssänger dann mit der guten Mutti, deren Augen unter dem zarten Tüllschleierchen noch immer wie eine Regendusche in Ergriffenheit tropften, im «Demel» auftauchte, musste dieser ohnehin schon arg gebeutelte Mann doch tatsächlich auch noch eine ganze Abendgage hinblechen.
DENN: Das liebliche Kind hatte hier im Laufe des Mittags gewütet und mit den Lippen gezittert. So hat es sich durch die ganze Auslage gefressen. MAN DARF RUHIG SAGEN: DANK DEM KIND HAT DEMEL ÜBERLEBT!
Natürlich setzte es zu. Aber: WOLLEN WIR HIER ÜBER FETTZELLEN REDEN, DIE SCHON ZUR KINDERZEIT ANGELEGT WERDEN?
Wollen wir nicht.
Aber meine Fettzellen führen auf Beethovens Grab sowie den «Demel» zurück.
Und wer kann so etwas in einer Zeit von Zahnspangen und «Zucker ist igitt!» schon von sich behaupten.
Das ältere Tantchen hüpft nun von seinem Stuhl. Und zeigt auf die lange Bar beim «Demel»-Eingang: «Gut, dass dies der Patron nicht mehr erleben musste … eine BAR! Wie in einem dieser Etablissemangs – Se wissen, wos y main…»
Ich ahne es.
Und tatschlich ist der Platz vor dem Tresen voll von laut lachenden Weibern. Sie lachen auf Russisch. Und die Serviererinnen lachen auf Russisch mit.
«Die sind jetzt überall …», unkt das alte Mädchen, «Wo is mai schöns olts Wien?»
Ich hätte sie gerne ins alte Wien auf den Friedhof geschickt – aber dorthin wird sie ja eh bald überführt werden.
Deshalb gebe ich mir einen Ruck. Und überlege, was «Schneekugel» auf Russisch heisst…