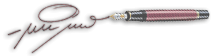«Ruf der Berge» – das ist nicht etwa das Neuste aus der Feder von Reinhold Messner. «Ruf der Berge» – so hat mein gütiger Vater 1956 seinen 8-Millimeter-Schmalspur-Film benannt, der ihn beim Klettern zeigt. Der Streifen wurde im Säli des Restaurants Hopfenkranz auf die Menschen losgelassen. Der Trämlerchor sang vor und nach der Spule.
Nun – die Begeisterung auf den Stühlen hielt sich in Grenzen. Der Zuschauer sah 90 Minuten lang nur Bergwände. Bergwände. Bergwände. Die Faszination war, als hätte einer das Küchenlager von Ikea abgefilmt.
Manchmal winkte der Vater in die Linse. Er hatte diesen verklärten Blick, wie sein Spross vor einem Berg Marzipankartoffeln.
Doch dann wieder: Fels, Fels. Fels … Ich meine: kein blühender Enzian … kein kreisender Adler, nur Natur nature. Und Berg pur. Sagen wirs mal so: Es war, als hätte jemand einen Coupe Danemark ohne Banane und Schokosauce serviert.
Wie ich in Adelboden unsern Estrich aufräumte (nach 60 Jahren muss es ja mal einer tun), stosse ich auf das Bergruf-Glück in Zelluloid. Es liegt in vier Filmdosen auf Spulen gerollt. Daneben stehen grob genagelte Bergschuhe von der Art, wie sie die Leute heute mit Trockendisteln gefüllt auf Chalet-Terrassen stellen. In all dem Berg-Gerümpel gibts auch eine vergilbte 20-Zeilen-Kritik. Sie stammt aus der damaligen Arbeiter-Zeitung: «Gewerkschafts-Genosse Hammel hat auf eindrückliche Art gezeigt, dass er nicht nur in der Politik hoch hinaus will… Höhepunkt war der traumhaft abgestimmte Chor mit seinem ‹Im Frühtau zu Berge wir gehn, fallera›.»
Ich vermute mal, dass der Sekretär des Trämlerchors den Bericht «mit der Bitte um Veröffentlichung» an die Redaktion geschickt hatte. Von jenem Abend weiss ich nämlich nur noch so viel, dass die Omi herzhaft in die Bergstille reinschnarchte, bis meine Mutter sie mit einem unsanften Rippenstoss in die dunkle Wirklichkeit zurückholte: «Es ist immerhin dein Sohn, Anna!»
Heute, rund 60 Jahre nach dem «Ruf der Berge», machen Bergdramas auf den Fernsehkanälen das volle Programm. Menschenmassen jagen den Eiger hoch. Und stürzen am Matterhorn ab. Der Mount Everest serviert zum Sonntagsnachtisch ein paar Bergleichen auf Eis. Und rechtzeitig zum Jubiläum der Matterhornbesteigung zeigt uns ein Hochglanzmagazin wieder diese Bergschuhe mit genagelten Sohlen. Nur sind darin jetzt keine Trockensträusse arrangiert. Sondern es ragen Skelettknochen hervor – Knochen der gefundenen Leichen. Man könnte sagen: Der Schuh war noch Qualität – der Mensch nicht.
So. Das mag jetzt sarkastisch klingen. Und ein Seelenklempner hat mir mal erklärt: «Sie haben sich bei ihrem Vater den Bergkoller geholt.» ABER DAS IST ES NICHT. ICH MÖCHTE EINFACH EINMAL AUFLISTEN, WESHALB DAS BERGSTEIGEN NUR DEN BERGSTEIGERN SPASS MACHT. Für meinen Vater waren die Berge eine Sucht, wie für den Junkie die Gier nach Heroin. Er konnte ohne nicht atmen. Wenn er auf einem Gipfel war, gierte er bereits nach dem nächsten. UND NUN DARF ICH MAL ERKLÄREN, WIE SO ETWAS FÜR DIE UMWELT AUSSIEHT:
1. Szene: Das Kind ist kaum vier Jahre alt. Chalet in Grindelwald. Die Mutter geht alle 15 Minuten ans Fenster. Sie will vor dem Vierjährigen stark sein, keine Tränen zeigen. Aber der Bub atmet die Unruhe. Und sieht die roten Augen. Dann hört er, wie die Mutter am schwarzen Telefon ihre Schwester anruft. «Das Wetter ist gekippt… ich hoffe, sie haben ein Biwak errichten können…»
Nach drei Tagen kommt der Vater zurück. Hände abgefroren (dank einer neuen Technik rettet ein Chirurg aus Basel seine Finger). Nase schwarz. Und die Beteuerung: «Ich schwöre es euch beim Jungen – ich gehe nie mehr!» Drei Wochen später hing er wieder am Seil – so wie der Süchtige an der Nadel.
2. Szene: Der Bub wird aus dem Schlaf geschreckt. Er hört ein Schluchzen. Schleicht in die Stube. Und sieht seinen starken, harten Vater erstmals weinen. Auf dem Tisch liegt ein Hemd getränkt mit Blut. Der Vater hält ein Seil in der Hand. Es ist gerissen. Sein bester Freund ist so in die Tiefe gestürzt. Immer wieder stammelt der Vater: «Ich habe ihn ungesichert aus 30 Metern Tiefe hoch geschleppt. Er war schon tot…» Die Mutter nimmt den Jungen bei der Schulter: «Geh wieder schlafen…» Das Kind schaut fassungslos auf das Blut. Auf den Vater. Auf das kaputte Seil.
Wieder das Weinen. Wieder der Schwur: «Das war das allerletzte Mal …» Es gab kein letztes Mal. Der Ruf der Berge war stärker.
Nun sollte sein Sohn auch mit. Aber der Bub hasste die Berge – er hasste den Vater, der diese Unruhe brachte. Und er dachte sich mehrere Male: Lieber Gott, lass das Seil diesmal mit ihm reissen. Mach ein Ende. Lass ihn nicht mehr zurückkommen. Das Kind hatte den Koller, wie der Seelenklempner das später richtig diagnostiziert hat.
Schlussszene: «Er wird an einem schönen Tag in seinen geliebten Bergen abstürzen» – erklärte die Mutter dem nun erwachsenen Sohn, als sie zusammen auf dem Chaletbalkon standen. «Und es wird ein guter Tod sein. Ich glaube, er wünscht es sich so…» Tatsache: Er war vernünftiger, als alle dachten. Er schraubte mit den Jahren die Schwierigkeitsgrade runter.
Als meine Mutter tot war, unternahm er nur noch lange Wanderungen. Und mit 85 musste ihn mein Freund Innocent mit einem Jeep an die Lohnerwand fahren. Er stieg aus dem Auto. Stützte sich auf zwei Stöcke. Und streichelte den Fels des Bergs, den er so viele Male bestiegen hatte. Dann weinte er wieder. Ich wollte damit nur sagen: «All diese Bergsteigerromantik, dieses Todessehnsuchts-Theater lässt viele leiden. Die eigentlichen Helden sind diejenigen, die unten geblieben sind. Und die Last auf sich nehmen – eine Last, die ihnen kein Mount-Everest-Träger abnimmt.
«Man kann nicht alles auf die Vergangenheit schieben – man muss einen Schlusspunkt setzen», hat der Seelenklempner mir erklärt. O.k. Schluss.
Ich öffne die Blechdosen mit den vier Filmspulen «Ruf der Berge». Das Zelluloid zerfällt in Staub. Gut so.