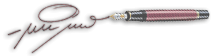Es ist Theater. Zirkus. Cabaret. Längst hat sich der gewöhnliche Alltag aus Roms Gassen weggeschlichen. Die wenigen Bäckerläden, die überlebt haben, gestalteten ihre Verkaufstheken zu Bars um. Hier können die Touristen Pizzastücke mit Käsefäden kauen. Und sich dazu eine gekühlte Cola aus dem Eiskasten reinzischen.
Die kleinen Ristoranti mit der Mamma-Küche sind verschwunden. Und wenn mal eine Mamma kocht, dann ist sie aus China und bruzzelt ihre Sau auf süss-sauer.
Die Alimentari-Läden mit ihrem Angebot, das von der Klo-Rolle bis zum getrockneten Kabeljau reichte, haben zu Souvenir-Shops mutiert. Hier erinnern Pinocchios aus Kunstholz an die Lügengeschichten ihres Landes. Die Kunstholz-Figur mit dem Aufdruck «Made in Taiwan» ist selber zur Lügengeschichte geworden.
Das eigentliche Rom hat sich in die weiten Aussenquartiere verzogen. Dort sieht es allerdings auch nicht anders aus als im Basler Gundeldingen Ost oder im Zürcher Kreis-Cheib: unschöne Wohnklötze, wo die Grossmütter das Fehlen eines Kellers für ihr Eingemachtes beklagen … Supercenters mit diesem Angebot, das heute über jede Registrierkasse auf der ganzen Welt geht … und Parabol-Pfannen auf Terrassen und Dächern, so dass es aussieht, als sei ein Heer von grünen Männchen in fliegenden Untertassen gelandet.
Wer das «echte Rom» erleben will, muss sich in einen der wackelnden orangen Busse setzen und zur Endstation fahren. Oder er steigt hinter der Piazza Venezia in die Tram Nummer 8 und lässt sich aus dem Theater wegschaukeln – dorthin, wo auf den grossen, öffentlichen Mercati noch Hühner mit Kopf und Leber, Kutteln in verschiedensten Qualitäten und römische Artischocken auf den abgewetzten Holztischen angeboten werden. Während die römische Hausfrau (wie überall: eine berufstätige Mutter) im Aussenquartier schnell mal für das Nachtessen eine Pizza holt, kurven im Herzen von Rom schwarze Vans mit abgedunkelten Scheiben Touristen aus China, Moskau und Tokio durch die engen Gassen. Der Führer neben dem Fahrer zeigt ihnen das Pantheon und die Via dei Condotti, wo die Japanerinnen einen entzückten Schrei ausstossen, wenn sie das Gucci-Label erspähen (und dann gleich mal eine Stunde für eine Einkaufsrunde einlegen).
Betuchtere, die für eine Rüttelstunde 200 Euro aufwerfen können, setzen sich in eine der Pferdekutschen, die hier «carozzelle» heissen. Das Pferd, diese arme Sau, keucht sich das Herz aus dem Ranzen, um die übergewichtige Familie aus Dallas zum Trevi-Brunnen zu bringen – der ist allerdings wieder einmal mit Plastik und Holz eingeschalt. Europa bezahlt die dringende Renovierung. Und Dallas ist stinkesauer, weil nur Plastik aufs Video gespult werden kann.
Gegen zehn Uhr morgens beleben sich die grossen Plätze mit Kunst. Junge Menschen aus aller Welt schleppen Requisiten, Gitarren, Mikrofone und viel guten Willen an.
Sie versuchen sich als Reinkarnationen von Pavarotti oder der Callas. Und sie haben die Mailänder Scala als Background-Orchester in kleinen Lautsprecher Boxen dabei.
Andere machen auf Marcel Marceau. Tünchen sich die Fresse weiss. Und sind zum Abwinken langweilig.
Und natürlich gibt es die Akrobaten – meistens aus dem Osten – die man auch vor Rotlichtern auf den Verkehrstrassen antrifft. Sie jonglieren Bälle, bauen Menschentürme, machen Überschläge und gehen dann mit einem Becher für ein paar Münzen herum.
Wird der Rummel zu hektisch, sodass kaum mehr ein Durchkommen und jedes Geschäft blockiert ist, alarmieren die Ladenbesitzer die Polizisten: «Jetzt tut endlich etwas!» Aber die zucken dann nur die Schultern: «Wir können nicht überall sein!»
Während früher italienische Tenöre mit der Gitarre von Beiz zu Beiz zogen und den Gästen das «Arrivederci Roma» um die Ohren schmetterten, sind diese schon längst von einer neuen Generation aus Russland, Bulgarien oder Rumänien weggefegt worden. Wunderbare Stimmen. Opernreif. Hervorragende Cellisten, Flötisten, Pianisten (kürzlich ist einer gar mit einem Flügel auf die Piazza Navona angefahren, bis ihn die Polizei verjagt hat – «das dann doch nicht!»).
Die Leute bleiben vor den Protagonisten im weiten Halbkreis stehen. Sie lauschen der kleinen Nachtmusik noch vor dem Mittagessen. Und sie sind entzückt über das «Nessun dorma», das tatsächlich opernhausreif rüberkommt.
Viele werfen Noten in die Kartonkistchen, in denen auch CDs für zehn Euro den unvergesslichen Moment anbieten.
Ljudmila war bis vor einigen Wochen der Star unter Roms Strassenmusikanten. Sie hatte das Leben in Moskau nicht mehr ausgehalten. Bestieg den Zug nach Rom. Und setzte auf ihre Stimme. Ihr Repertoire umfasste alle berühmten Opernarien für einen Sopran – und selbst die Polizisten verliessen ihre Überfallwagen, mit denen sie den Leuten auf den Piazze ein gewisses Sicherheitsgefühl geben wollen – («BEI UNS PASSIERT NIX!»).
Alle waren vom Zauber Ljudmilas Stimme gefangen. So auch ein Redaktor des Staatssenders Rai Uno.
Er lud das Mädchen zur Talentshow ein. Sie gewann. Und Rom ist um eine Innenstadt-Attraktion ärmer, weil Ljudmila von der Stelle weg für die Puccini-Festspiele nach Torre del Lago verpflichtet wurde.
So ist die Ewige Stadt eben immer noch für ein Wunder gut. Und lockt die Menschen aus aller Welt an, damit hier jeder sein eigenes «Miracolo» erleben kann.
Die Römer selber bauen da weniger auf die Stadt, die Artisten-Kulisse oder gar ihre Politiker. Für ihre Wunder sind die Kirchen zuständig.
Hier hat sich tatsächlich nichts verändert: Noch immer werden täglich Kerzenlichter angezündet und die Hoffnungen zum Himmel geschickt. Man wünscht sich von den Heiligen ein Land, das funktioniert. Eine Regierung, die nicht korrupt ist. Eine Arbeit, die eine Familie ernähren kann …
Aber die Heiligen haltens da mit den Polizisten: Wir können nicht überall sein …