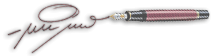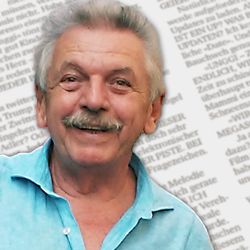Immer an Silvester warf sich Julchen einen schwarzen Fummel an.
Sie schminkte sich die Augen rabendunkel, so dass sie aussahen, als wären sie ins Tintenfass gefallen. Und an ihren Läufen zischten dunkle Nylonstrümpfe mit Nähten (was mein Vater an seiner Schwägerin sexy fand und sie entsprechend auch immer mit dem anerkennenden Pfiff des Sexer-Trämlers zur Jahresend-Party willkommen hiess - ein Pfiff, der ihm bei seiner (zumeist) weiblichen Fahrkundschaft den Beinamen „pfeifender Hansi“ einbrachte.
Julchen trauerte.
Sie trauerte um die Zeit, die – „wie ein Schnellzug in der Poebene“ (so sagte sie) - davonjagte. Sie trauerte, weil sie wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho hatte („und du hast noch immer keinen Mann, Julchen“, kommentierte die klassische Seite des Clans einen so erbarmungswürdigen Zustand ).
Aber Julchen war eh auf der Trauerweidenseite dieses Lebens gelagert – sie lächelte selten. Und keine schrieb nettere Kondolenzbriefe als sie…
Julchen war Mutter’s jüngste Schwester. Als zehnjährige trug sie das weisse Röckchen mit der Kerze. Und wollte ihr Leben IHM weihen.
Mit 15 rauchte sie Shit und trug als erste in Aesch (Kanton Baselland) grüne Fingernägel. Damals bedeuteten grüne Fingernägel „verdorben! verdorben! verdorben!“.
Also schickten sie Julchen ins Internat.
Im Internat zeichnete sich die junge Frau aus Aesch in Algebra und der lesbischen Liebe aus. Als Julchen zurückkam trug sie einen gestreifelten Herrenanzug, Schlips und einen Hut wie Humphrey Borgard in „Casablanca“.
Wenn die Freundinnen meiner Grossmutter mit Bemerkungen wie „Julchen benimmt sich aber seltsam – sie hat gestern an der Teppichstange 50 Klimmzüge hingelegt“ nicht geizten - wenn also die Umgebung über Julchen lästerte, zeigte sich die Oma gelassen. „Ach ja? – Hugo ging bis sieben Jahre nur mit einem Ballettröckchen ins Bett – und schaut ihn euch heute an!“.
Hugo war das Karnickel der Familie. Kein Rock war vor ihm sicher.
Mit 25 Jahren war die lesbische Phase bei Julchen vorbei und gegessen. Sie hatte sich immer eine Freundin gesucht – aber damals gab’s kein Internet. Somit auch keine Auswahl. Und die Zeit rannte ihr davon.
Sie wurde Architektin. Baute miese Reihenhaus-Siedlungen. Und verdiente sich dumm und dämlich.
„Mit dem vielen Geld könntest du dir zumindest mal einen anständigen Rock kaufen!“, war das letzte, das ihre Mutter ihr auf den künftigen Weg mitgab.
So etwas verbitterte Julchen. Und: „sie hat mich nie geliebt!“, sagte sie mit Grabesstimme vor dem Loch, als vier Männer den Sarg mit der Oma drin an den Seilen in die Grube poltern liessen.
Seit jenem Moment trug Julchen Trauermine non stop.
Allerdings muss ich sagen, dass es Julchen war, die sich immer um mich gekümmert hatte. Sie war stets für die neuste Mickey-Mouse-Ausgabe sowie für eine Packung Bazooka-Kaugummi gut. Sie zeigte mir, dass Marihuana nicht nur gegen Zahnschmerzen eingesetzt werden kann und welche Wirkung Kondome mit Wasser gefüllt als Knallbomben vom dritten Stock abgeworfen bei ahnungslosen Passanten erzielen.
Julchen trug immer diese leicht bewölkte Miene, als wäre sie Lady Macbeth und müsste ihre Kinder ermorden. Und selbst wenn sie einen Witz erzählte, brachte sie den mit trauerumflorten Unterton, was die Pointe natürlich grossartig steigerte und später an Retorik-Seminaren für Jungunternehmer als „Julianischer Verfremdungs-Effekt“ in die Lehrbücher einging.
Ich liebte meine Trauerweidentante. Mir gingen schon als Kind diese hysterisch-fröhlichen „jetzt feiern wir ab!“-Stimmungsraketen auf die Eier. Und Witze-Erzähler, die einen Silvester-Abend lang jede Blondinnen-Pointe dadurch killten, indem sie keinen Schimmer vom Julian’schen Verfremdungs-Effekt zeigten, sondern schon immer vor dem letzten Satz nicht mehr an sich halten konnten und drauflos brüllten – ALSO DIE WAREN DAS ALLERLETZTE.
Ich war 20 Jahre alt und hatte eben meine ersten Liebesabstürzte hinter mir, als Julchen im Trauerlook zu Mutters Silvester-Fete erschien. Ich hatte mir die Augen auch schwarz geschminkt und trug Kunstseide in Anthrazit.
„Es ist Zeit, das alte Jahr hinter sich zu lassen – und die neue Zeit willkommen zu heissen!“ rief Mutter fröhlich vor ihrem Berg mit handgestrichenen belegten Broten.
Julchen und ich gingen auf die Terrasse. „Diese hektische Fröhlichkeit nur weil ein Jahr zu ende geht, pisst mich echt an!“, sagte die Tante. Dann drehte sie sich zu mir: „…und glaube nie, dass das Neue besser wird, als das alte. Das wollen sie dir zwar alle einpauken, Werber, Pfarrer, Politiker. Aber es ist immer dieselbe Scheisse – wichtig ist nur, dass wir mit dieser Scheisse richtig umgehen können!“.
Sie puffte mich in die (damals noch)schlanke Taille: „Mit der Liebe ist es übrigens dasselbe…glaube nicht, dass etwas Besseres nachkommt! Mach einfach das Beste daraus…“
Die Glocken hiessen das neue Jahr willkommen. Und Julchen erzählte nachdem sich alle in den Armen gelegen hatten, den Witz vom schwangeren Floh. Mit Trauermine. Und mit Julian’schem Verfremdungseffekt.
Es war meine letzte Silvesterfeier mit der Familie.
Vier Monate später rief mich Mutter in Rom an: „Julchen liegt im Spital - es ist nichts mehr zu machen…“
Ich fuhr noch mit dem Nachtzug in die Schweiz. Meine Tante lag abgemagert auf einem dieser milchweissen Spitalbetten. Sie drückte meine Hand – ihre Augen waren so dunkel, wie damals als sie zur Silvesterfeier schwarze Ränder geschminkt hatte.
„Die Zeit geht so schnell – nicht nur am Silvester. Ein Leben lang…“, sie hustete: „Es ist wirklich wie der Express-Zug in der Poebene…“.
Und plötzlich lächelten ihre Augen – sie lächelten so warm wie ein Feuer und so schön, wie ich sie nie gesehen hatte: „Nutz jeden Tag. Und mach‘ das Beste draus…“
Als ich das Krankenzimmer verliess, weinte ich.
Und mir wurde bewusst, dass wir mit Julchen immer gelacht, aber nie geweint hatten.