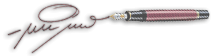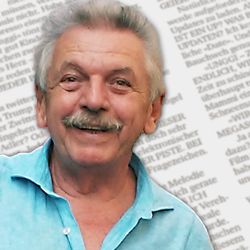Zu Hause redeten wir vom Schlössli.
Da Mutters schönstes Kind immer mit dem Gedanken spielte, es sei nach der Geburt verwechselt worden, und darauf hoffte, dass irgendein Königshaus den schrecklichen Irrtum bemerken und den wunderbaren Jungen auf den Thron zurückrufen würde ? kurz, da ich eh einen «Schuss» (wie der plebejische Vater es nannte) hatte, wähnte ich mich an trüben Tagen auf der sonnigen Terrasse des Familienschlosses. Ich würde wie schon Königin Mutter freundlich, aber nicht ganz so gütig den Untertanen vom Balkon zuwinken, Luftballons ans Volk verteilen und es über seinen jubelnden Köpfen eine Minute lang «Old Spice» regnen lassen.
Mein Vater besprühte sich damals mit «Old Spice». Alle Trämler taten das. Ich fand den Duft irre geil ?
Die Geschichte mit dem Schlössli wurde vom Schicksal geschrieben: Mutters Patin (die Schwester meiner Grossmutter) vermählte sich mit einem italienischen Grafen. Meine Grossmutter, die sauer war, dass der Graf nicht bei ihr angebissen hatte, behauptete immer, Elly habe dem Hallodri, als er synchron um die beiden Weiber warb, auch den letzten Schritt zugestanden. Jedenfalls sei ihre Schwester nicht als Jungfrau zum Altar getreten ? aber sie, die Oma, habe gewusst, was sich gehörte. Und sich dem Grafen stets eisig verweigert.
Schön blöd! Man kann doch mal für so ein Schloss mehr als die Bluse öffnen!
Jedenfalls fiel der Adel dann nicht direkt auf unsere Linie. Sondern nur nebenan. Aber immerhin kam jedes Jahr auf Weihnachten eine Flasche Wein mit dem Fünf-Sterne-Wappen der Isottas drauf. Dazu die Aufforderung an die Patentochter: «Besucht mich im Sommer ? bringt das Kind und Maggi-Würfel mit!»
Noch heute muss ich bei Salaten, die zu stark mit MaggiWürze angemacht werden, an italienischen Adel denken.
Das Schloss hat beim Kind, dessen Wurzeln in einer Drei-Zimmer-Wohnung lagen, einen riesigen Eindruck hinterlassen. Besonders der Eingang mit dem Steinwappen über dem Riesentor. Und dann der gigantische Lüster im Esssaal, mit dem ich später bei meinen Freunden dick angab («auf dem Schloss unserer Familie funkelt im Spiegelsaal ein Lämpchen, da ist jeder verdammte?Phantom of the Opera?-Kronleuchter ein billiges Flämmchen dagegen ?»). Den Hang zu den Maggi-Würfeln der Schlossherrin verschwieg ich.
Als ich mich dann mit dem Schicksal einer Trämlerstochter anfreunden konnte und die Hoffnung auf den Thron endgültig auf das nächste Leben verschob, rückte das Schloss der Grosstante in weite Ferne. Ihre Tochter hatte das Gut übernommen. Sie lebte als Jungfrau froh und heiter dort. Überdies wollte sie keine Seele sehen, ausser den Dorfpfarrer, der jeweils vom Ortasee zum Schloss hochradelte, um ihr die Beichte und das Geld abzunehmen. Mein italienischer Vetter Antonio lamentierte, nicht einmal er (und immerhin sei er ja ihr direkter und einziger Neffe) habe Zutritt. Die Alte verbarrikadiere sich hinter den Mauern. Zeige sich nie im Ort. Und lebe, nachdem die Kirche auch noch den letzten Centesimo aus ihr herausgedrückt habe, in Armut. Alleine. Und nur in der Küche. Die andern Räume seien verschlossen.
Immerhin war der Nachfolger des Padre so gütig, uns vom Ableben «der guten Seele» zu berichten.
Antonio und ich jubelten synchron «finalmente!» ? und dann ab nach Orta!
Endlich war das Schloss unser.
(Na ja ? eigentlich erbte es auf dem Papier Antonio, aber so etwas muss man unter Vettern nie so genau nehmen.)
Wir jagten also zu diesem winzigen See mit den mächtigen Villen darum herum. Unter den majestätischen Bauten suchten wir das Schloss. Und stiessen bei den Leuten immer nur auf erstauntes Kopfschütteln: «Castello? Castello? ? Ma non c?è, Signori ?»
Der Ortspolizist von Omegna fuhr uns dann auf seinem Moped voraus. Er führte uns in ein kleines Dörfchen, das sie Agrano nennen: «Hier hat die Signora gewohnt ?», brüllte er uns unter seinem senfgelben Helm zu. Dann zeigte er auf eine vergammelte Haustüre, die weit offen stand.
Über der Türe sah man noch einen der fünf adligen Sterne der Isottas. Der Rest war abgebröckelt. Und Zerfall.
Wir tasteten uns über Schutt, verrostete Gartenstühle und verlotterte Canapés zum Garten vor. Die Vergangenheit war mit stacheligen Beerenstauden überwuchert.
Das Schlösschen zeigte sich düster. Und war geschrumpft. Oder anders: In unsrer Erinnerung hatten wir es mit jeder Erzählung mehr aufgeblasen. Jetzt war die Blase geplatzt: eine verfallene Hütte, wo irgendwo noch ein gigantischer Kronleuchter hängen musste.
«Zumindest den Kronleuchter schnappen wir uns!», sagte ich zu Antonio.
Der Esssaal war dann nur ein kleines Kämmerchen. Der einstige Marmorkamin war zugemauert. Und über dem kleinen Esstisch baumelte statt des Lüsters eine Lampe von Ikea aus der Serie «Schwedisches Nordlicht».
«Em-be», sagten wir nun beide.
Wir kämpften uns durch die Aussentreppe zu den drei Schlafzimmern im oberen Stock durch. Gemeinsam hoben wir eine der Holztüre aus den Angeln.
Im Zimmer stank es fürchterlich nach Abgestandenem, Mäusescheisse und Feuchtem. Das Einzige, das überleben konnte, war der Pilz an den nassen Wänden.
Ich öffnete die schmale, hohe Türe, die auf eine Gasse hinausging. Eine Schar von Tauben flog genervt auf. Und dann stand ich auf diesem Balkon, von dem ich als Kind immer geträumt habe. Er war drei Hand breit ? und zehn Fuss lang.
Symbolisch habe ich meinem Volk zugewinkt. Auf den «Old Spice»-Regen habe ich verzichtet.
Im Zimmer donnerte eines der alten Porträts von den feuchten Wänden. Es war Mutters Patentante Elly ? jene, die den Conte noch vor dem Altar zugreifen liess.
Sie schaute mich streng aus dem Rahmen an. So ungefähr: «Hast du Maggi-Würfel mitgebracht?»