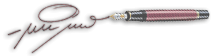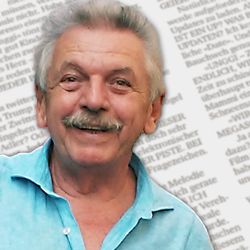Das Haus steht im Regen. Und dieser schüttet durchs offene Dach. Auf der Wiese liegen Badewannen herum. In den Badewannen verkriechen sich verkohlte Puppenköpfe. Ein halber Davoser Schlitten steht gespenstisch im hohen Gras, Bergschuhe, die nur noch schwarze Klötze sind, wissen nicht wohin sie gehen sollen.
Das Ganze könnte als makabere Szenerie einer Kunstinstallation durchgehen. Aber Kunst ist nie so makaber wie die Wirklichkeit.
Das Adelbodner Bauernhaus gehört meinem Nachbarn Gottfried. GEHÖRTE. Denn vor vier Wochen ist es abgebrannt. Bis auf den Grund.
Gottfried und seine Frau haben die paar trockenen Juli-Momente zum Heuen genutzt. Sie standen am Kuonisbergli, als sie zusehen mussten, wie Flammen aus ihrem Giebel zum Himmel züngelten. Mit einem Schrei rannte die Mutter ins Haus. Rettete ihre kleine Tochter, die sie vor einem halben Jahr geboren hatte, aus dem verrauchten Zimmerchen. Eine Minute später loderte das alte Holzhaus wie ein ausgetrockneter Weihnachtsbaum. Und brach in sich zusammen. Gottfried, der Bauer, stand erstarrt da. Seine blauen Augen hatten diesen stummen Blick der Verzweiflung. Als die Mutter mit der Tochter auftauchte, weinte er. Seine Frau hatte ihn noch nie Weinen gesehen.
Das Haus war für mich Kindheit. Ein wichtiger Teil davon. Hier gab es Kühe im Stall. Hier sah ich zum ersten Mal, dass nicht der Storch die Jungen bringt. Und hier durfte ich neugierige Ziegen, frisch geborene Kälbchen und Katzen streicheln.
«WARST WIEDER BEIM GÖPFI?!», bruddelte die Mutter. «DIE HABEN ANDERES ZU TUN, ALS AUF EINEN STADTHÖSI AUFZUPASSEN. UND JETZT AB IN DIE BADEWANNE...»
Die Besuche im alten Bauernhaus waren stets mit einem unendlichen Duftbouqet verbunden. Die Düfte legten sich wie ein warmer Mantel auf uns. Mutter mochte diese Düfte nicht: «UND SCHRUBB DICH GRÜNDLICH DURCH!»
Meistens tauchte ich zum Frühstück im alten Haus auf. Die Küche war dunkel. Nur das Holzfeuer im Herd strahlte manchmal kurz auf wie die Sonne über dem Wildstrubel. Das Feuer brannte nonstop. Es gab immer etwas zu kochen. Teewasser... Badewasser... ein Stück vom Schaf, das sie auf einem Blech mit Kräutern eingebettet hatten.
In einer Gusseisenpfanne, alt wie der katholische Glaube und schwer wie das Los der Bergbauern, dampfte die Röschti goldgelb vor sich hin. Anna, die Bäuerin, steckte den Kochlöffel in den bläulichen Steinguttopf. Und stach nussgrosse Portionen von der gesottenen Butter ab. Diese verteilte sie summend auf der Röschti. Und endlich sassen alle vor ihrem Mucheli Milchkaffee.
Die Röschti kam in der Pfanne auf den Tisch. Man stach mit seinem Löffel aus der Pfanne davon ab. Und es war ein Gruss aus einer andern Welt.
«Die brauchen mit Butter eben nicht zu sparen...», reagierte Mutter etwas gereizt, als ich ihr erklärte, dass Oeschters Röschti tausend Mal besser schmecke, als dieser dünne Fladen, den sie uns mit Spiegeleiern auftischte.
Als dann die Bauernhochzeit von Gottfrieds Schwester anstand, war ich nicht mehr aus dem alten Haus wegzubringen. Tagelang wurde «gchüechelt». Die Nachbarinnen halfen den Teig der «Schlüüferli» und «Chnöiplätz» zuzubereiten. Auf offenem Feuer zischte das Fett? und Zaine um Zaine wurde mit Herrlichkeiten gefüllt. Zöpfe, so lang wie drei Bauernarme wurden aus dem Holzofen gezogen? und zärtlich zischelte der goldgelbe Eierteig der «Brätzeli» auf dem glühenden Waffeleisen, um bald einmal zu hauchzarten Scheiben mit Schweizerkreuzen oder einem Edelweiss drauf zu erstarren. Gottfried und ich sassen unter dem Tisch. Hin und wieder fiel ein «geplatzter» Chnöiplätz oder ein halbes «Brätzeli» für uns ab. Wir schleckten uns durch die Teigresten und spülten mit der noch lauen Kuhmilch nach.
Als wir Gottfried zu einem Gegenbesuch («Wir müssen uns doch mal revanchieren!»? so Mutter), als wir Gottfried also zu uns nach Basel einluden, schaute er sich im grossen Haus ehrfurchtsvoll um. Er betrachtete stumm Mutters Gobelinstickereien, bewunderte Vaters Zinnkannen und schüttelte dann bei meinem Kinderschreibtisch stumm den Kopf: «U de... wo sy de eurer Chüüeneni...?» Wir hatten keine Kühe. Und somit ein Manko. Als er dann die Milch sah, die aus dem Tetrapack kam, wollte Gottfried wieder heim.
Sieben, acht Generationen hat die Familie im alten Bauernhaus gelebt. Der kleine Blumengarten mit dem nachtblauen Rittersporn und den filigranen Zittersternen war der Stolz der Grossmutter gewesen? die goldenen Medaillen an der Stallwand der Stolz des alten Bauern: «Euse Muni isch de gäng no de heissischt Hängscht im Stauu...» Sie nannten ihn «Herr Brando».
Es war ein Elektrodefekt im neu angebauten Schober, der das Feuer entfachte. Innert zwei Stunden waren 400 Jahre Geschichte niedergebrannt. Nun schüttet der Regen seit Tagen durchs Dachgerippe. Die Linde steht dunkel wie ein Trauerbaum vor der Ruine. Das Feuer hat die Äste verkohlen lassen. Die Bauernfamilie ist in einer kleinen Wohnung untergekommen. Aber die Arbeit wartet. Das Heu muss eingefahren, die Kuh gemolken. Die Kinder gefüttert werden. DAS LEBEN GEHT weiter. Und die Geschichte auch. «Gottlob ist der Frau und dem Kind nichts passiert», sagt Gottfried.