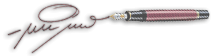Dessert ist Teufelszeug.
Also weglassen.
Und Nachspeisen kreieren, bei denen jedem die Tränen kommen. BITTERE TRÄNEN.
Wer in einem Nobel-Restaurant ein Dessert bestellt, wird mit einem schwungvoll hingeworfenen Strich aus Beerensauce konfrontiert. Es könnte auch das mysteriöse Warnsignal einer andern Galaxis sein: «SCHLEMMEN TÖTET!»
Auf der Sauce irren drei geviertelte Stück Erdbeeren umher.
Der Höhepunkt ist ein taubeneiförmiger Klacks Speiseeis: ein wässriges Sorbet, das sich als «Variation von wilden Pampelmusen» anbietet.
Wer denkt da bei so viel Traurigem nicht ans Sterbebett. So.
Ich will nicht hadern. Und ich will die Vergangenheit nicht süsser machen, als sie war.
Aber wenn ich mir in Adelboden zum Nachtisch im Café Haueter eine Meringue auffahren lasse, dann schaut die Umgebung so entsetzt, als hätte ich eine Nuklearbombe gezündet.
Die aufgesperrten Augen signalisieren: «BITTE NEIN – ABER NICHT BEI DIESEM ÜBERGEWICHT!
VÖLLEREI IST MIESER GESCHMACK.
UND DANN NOCH IN EINER ZEIT, DA FLÜCHTLINGE ZU ZIGTAUSENDEN DURCH DIE WÜSTE IRREN ... WO BLEIBT DAS SCHAMGEFÜHL?»
Ohgottohgottohgott. Ich schäme mich.
Schuldbewusst senke ich den Blick auf den künstlich aufgepufften Rahmberg. Und wie ein geprügelter Hund verlasse ich in Demut das Café.
Die Gäste atmen triumphierend auf.
Vis-à-vis, bei Bäcker Michel, lasse ich mir dann ein Stück vom Bienenstich einpacken.
IN MEINEM MUND RAUSCHT DER SPEICHEL WIE DER ENGSTLIGENWASSERFALL.
So flüchte ich mit meinem Päckchen in Richtung Kuonisbergli. Mit Tannenästen und Laub getarnt verschlinge ich hastig das Kuchenstück hinter drei fetten Eichen.
Und zu Hause höre ich Vorwürfe wie «DU HAST SCHON WIEDER ...!», nur weil noch ein Mandelsplitter am Mundwinkel klebt. Und nach Nachschub schreit.
Wir rüsten überall zum Krieg auf – das Einzige, das noch weltweit abgerüstet wird, sind Kalorienbomben.
Meine Mutter war nicht eben das, was Gourmetkritiker als «begnadete Sternenköchin» eingestuft hätten. Um es auf den Punkt zu bringen: Sie kochte unter jeder Sau.
Ihr Kartoffelstock kam pulverisiert aus der Tüte. Und das Schlemmerfilet, um das sie ein Riesentheater losliess und es «poisson de Bombay» nannte, schwamm tiefgefroren aus dem Hause Findus in den Auftauraum.
Noch mit 16 Jahren glaubte ich ihr «Riz Casimir» sei einsame Spitze, nur weil sie Onkel Ben mit einer Büchse Fruchtsalat aufmischte.
Und ihre legendären «Spaghetti Napoli» waren so weich gekocht, dass sie auch als Schnellsüppchen durchgegangen wären.
Ihr Zauberparfum hiess MAGGI.
An, auf und über alles wurde die Flüssigkeit aus der braunen Flasche mit dem gelb-roten Mantel geschüttet.
Mutti gewöhnte ihre Sippe an den Saft wie die Katze ans Kistchen. Wen wunderts, dass mein Vater noch mit 80 in Stuckis Gourmet-Tempel beim Trüffel-Soufflé nach dem Maggifläschlein bellte.
Wie alle Menschen, die sich ernähren, aber nicht geniessen oder geniessen lassen, würzte auch meine Mutter die Küche der andern mit gut gepfefferter Kritik.
Kaum sass sie irgendwo an einem gedeckten Tisch, rief sie nach Pfeffer und Aromat, schüttelte missbilligend den Kopf: «Ja Herrgottnochmal! Dieses Huhn schmeckt nach gar nichts, Käthy» – und zerfetzte so jede Henne auf dem Teller parallel zur Moral der Gastgeberin.
Zum Schluss der Mahlzeit angelte sie ein kaum fingergrosses, grün-weisses Mundspray- Döschen aus der Handtasche. Sie drückte drei Mal ab. Dann sagte sie: «So!» Steckte sich eine Menthol-Zigarette zwischen die blutrot geschminkten Lippen. Und räucherte die Tafel aus.
Wenn mein Vater zu Hause seinem «Unsensibelchen» Vorwürfe über solch barbarisches Verhalten machte, schaute sie ihn an, als sei er eben von einem andern Planeten gelandet: «Du willst mir doch nicht sagen, dass dir Käthys Gummiadler geschmeckt hat; der kam fixfertig vom Hähnchen-Hansi und ist einfach nochmals aufgegrillt worden!» Dann klopfte sie ihrem Alten freundschaftlich auf die Schulter: «Mach dir nichts draus, ich habe noch eine Büchse Ravioli auf Vorrat!» So schrecklich sich meine Mutter auch durch die sogenannten Hauptgänge wurstelte – umso genialer war sie im süssen Bereich. HIER GING DIE POST AB.
Entsprechend wurden wir schon als ganz kleine Kinder auf Desserts getrimmt – so quasi: «VERGISS ALLES DAVOR. DAS DANACH LÄSST HOFFEN.»
Als sie im damaligen Blatt für alle zur «Reine de la Mousse au Chocolat» erkürt wurde, weil eine Jury (zusammengestellt aus der Märchenfee Trudy Gerster und dem Gesangswunder Lyz Assia) ihr luftiger Süssschaum zum «besten Dessert des Jahres 1964» ausrief, da war Mutter nicht mehr zu bremsen. Sie verschickte Einladungen auf Goldbüttenpapier «La Reine de la Mousse au Chocolat» bittet zum Dinner ...
An ihrem Geburtstag wollten wir der Guten eine ganz besondere Freude bereiten. Wir luden sie nach Zürich in die «Kronenhalle» ein. Das wunderschöne Restaurant galt schweizweit als Tempel aller Schoggimousse-Geniesser. Zu spät merkten wir, dass die Reise ein riesiger Fehler war.
Wortlos schaute «La Reine de Schoggimousee» nach einem köstlichen Essen (das sie konstant mit ihrem persönlichen Maggifläschlein braunwürzte), wie der Wagen mit der Dessertspezialität vorfuhr. Sie schnaubte ungehalten, als die Kellnerin mit weissen Handschuhen ihre Crème fraiche zur schimmernden Köstlichkeit löffeln wollte: «Ihr habt ja nicht alle – CREME FRAICHE!»
Sie züngelte nur kurz probehalber am Ganzen. Und gab den Löffel ab: «Selten schlecht!»
Dann griff sie zum Mundspray. Und zur Menthol-Zigarette!
Fazit: So betrachtet ist es doch wahrlich ein harmloses Vergehen, wenn ihre Nachkommen heute in Adelboden hinter der Tanne einen Bienenstich reinschieben.
Die Menschheit ist verbittert – und die süssen Seelen haben das Nachsehen.